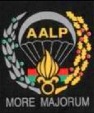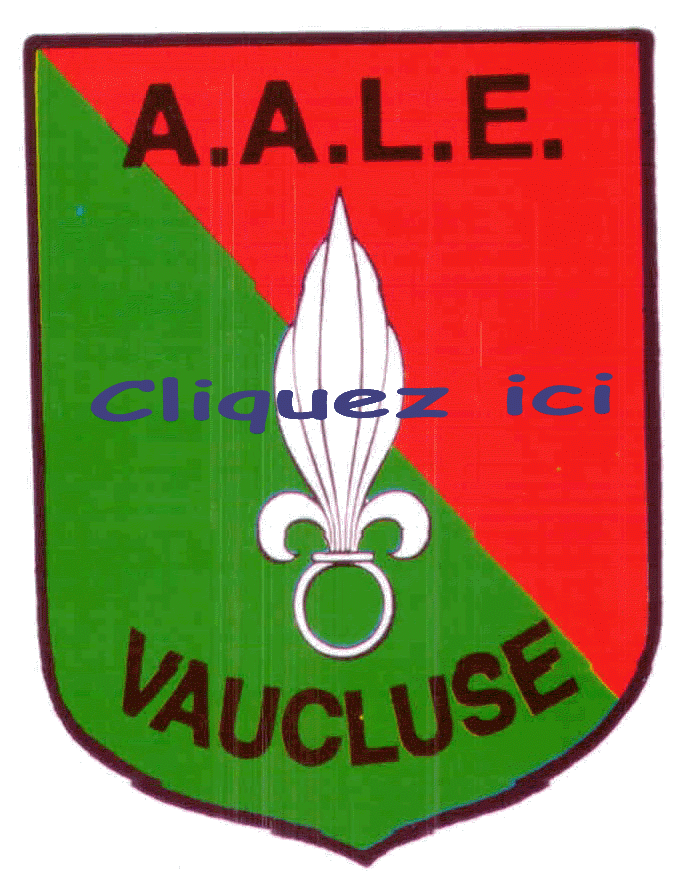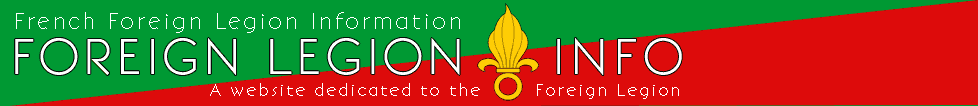Samstag, 29. November 2014
TEIL 1
In den Wirren des zu Ende gehenden 2.WK zogen sich viele Schwarzmeerdeutsche mit Wehrmachtseinheiten zurück. So auch Arthur mit seiner Mutter und der Oma. Über das tschechische Zneim, bekannt durch den Gurkenanbau, landeten sie nach einigen abenteuerlichen Erlebnissen im Schwäbischen, Nähe Stuttgart.
Arthur absolvierte brav seine Lehre und nach dem Abschluss wollte er fort, in die Ferne. Hier im Bottwartal war es zwar schön. Es gab ein Ruderverein, schöne Weinberge, Kartoffelsalat, Maultaschen, einen guten Trollinger zu einem deftigen Zwiebelrostbraten, den man sich kaum leisten konnte. Zwei Burgen in Oberstenfeld und Beilstein und ein Schloss Adelmann in Kleinbottwar rundeten das Bild einer heimatlichen Idylle ab. Doch es fehlte was. Langeweile plagte Arthur.
Einen Onkel hatte er in den USA, in Minnesota. Im Weltatlas musste er nachschauen, wo dieses Minnesota überhaupt steckte. So schrieb er einen ausführlichen Brief, begab sich fein gestriegelt zum Fotografen, ließ sich mit teurem Geld extra in Farbe ablichten und legte diese Fotografie von sich dem Briefkuvert bei. Dann brachte Arthur den Brief zur Post und wartete und wartete. Woche für Woche, Monat für Monat vergingen. Bedauerlicherweise kam nie eine Rückantwort.
Ein Tête à Tête mit einer verheirateten Dame des Ortes gab Arthur den letzten Ruck, um vorprogrammiertem Ärger aus dem Weg zu gehen und seine sieben Sachen zu packen. Er beschloss kurzerhand, sich auf eigene Faust in die USA an die kanadische Grenze, nach Minnesota in die Stadt Duluth an den Lake Superior zu begeben.
In Stuttgart wurde eine Fahrkarte gelöst und er saß im Zug.
So kam Arthur mit seinen wenigen Habseligkeiten und seinem Hohner – Akkordeon nach stundenlanger Fahrt in Bremerhaven an. Informationen über Reisemöglichkeiten in die neue Welt einzusammeln war erstmals seine Hauptaufgabe.
Auf seinem morgendlichen Weg zur Auslauftafel für ablegende Schiffe traf Arthur auf ein paar braungebrannte Kerle, welche gerade von der glorifizierten Fremdenlegion entlassen wurden. Sie schwärmten von Indochina, dem Exotischen und den willigen Weibern.
Nun war es Anfang Oktober 1951 und Arthur hörte einen ehemaligen Legionären interessiert zu. „Wenn du hier rumsitzt und auf deiner Quetschkommode `La Paloma´ klimperst, dann wird nix aus dir. Als Tipp von mir. Begebe dich in die im französischen Sektor gelegene Rekrutierungsstelle in Offenburg. Hier hast du ein Päckchen Gaulloise zur Einstimmung. Übrigens, nach der Unterschrift kriegst du einen Batzen Franc als, wie soll ich sagen `Eingliederungshilfe´?
Das Geld bekommst du aber erst, wenn du von Marseille in Oran gelandet bist. Machs gut“ und weg waren die ehemaligen Legionäre. Marseille, Oran, Indochina, was für wunderschöne Namen. Mit einem Augsburger namens Erwin Kieling, den er in einer Hafenkneipe kennenlernte, wollte sich Arthur zur Sammelstelle für die Rekruten am anderen Tag begeben. Vorher konnte Arthur noch sein Akkordeon versilbern, denn so langsam ging ihm das Geld aus. Erwin, der ebenfalls den Weg in die Staaten suchte, war ein großer, schlanker, breitgebauter Hüne, ein Blondschopf mit lockigen Haaren. Immer sauber rasiert. Seine blauen Augen leuchteten voll Tatendrang und suchten ständig nach Blödsinn.
Erwin war neugierig und wollte den Grund wissen, warum Arthur sich jetzt zur Legion begeben wolle. „Puhh, so recht gibt es da keinen triftigen Grund, ich wollte nach Amerika wie du, zu meinem Onkel. Aber ich weiß ja nicht mal, ob er überhaupt existiert oder ich willkommen bin. Und zurück zu meiner Mutter traue ich mich jetzt auch nicht mehr“. Kurzes Schweigen. „Dann hatte ich auch noch ein Tête â Tête mit einer Verheirateten. Feigheit vor dem Feind sozusagen. Jetzt muss erst mal Gras über die Sache wachsen. Zudem möchte ich zu Hause nicht versauern. Wohlfühlen, dort als Flüchtling? `Reigschmeckter´, sagen die Schwaben zu uns, das kann ich nicht gebrauchen. Ich muss raus in die Welt, atmen, was Vernünftiges erleben“.
Nach einer Schweigeminute fragte Arthur ihn das selbige zurück. Im bayrischen Akzent gab dieser von sich: „Ja woißt, i bin agentlich ka Lump, aber i trink ganz gern a Maß guots Bier. Guot und gern no a paar Stamperl Kräuterschnaps dazu. Da hab i mit moim Spezel, dem langweiligen Alois, dem Depperten, auf em Bockbierfest a paar gsuffa. Da hat mi so an bsoffener Hasen mit solchen, dabei deutete er Übergroßes an, „großen, schönen Euter ka Ruh glassen. Da Alois war scho recht bsuffa und der Hasen und i ham halt gschunkelt. Da simma uns näher und näher komma. Noch a Schnapserl hier, noch a Schnapserl da und wir ham scho a bisserl unterm Biertisch gfummelt, bis ma naus sind.
Da schnackelte i halt den dicken Brummer schnell hinterm Bierzeltel und guot is, so dacht i. Ihr Alter kam da plötzlich afach ums Eck, mit zwa andre und gab mir a ordentliche Watschen und ihrer au glei zwoi. Links und rechts and Backen hin. Da hab i durchdreht. I nam an Maßkrug und zerdepperte den schönen Krug auf sanem blöden Schädel und bin tapfer gflüchtet. In dr Zeitung, im Lokalteil, las i am andern Tag, dass es dr Stadtkämmerer war und er nun im Koma im Marienspital liegt. Horch, was jetzt Schlimmes kommt: Auf mi is a Geldel, `für Hinweis auf den Täter´, von 150 Markel ausgsetzt und jetzt bin i eben hier und will fort. Des han bestimmt seine Spezel veranlasst. Die Drecketen. Zrück trau i me nimmer, denn er is au in der Kommandatur bei der Feuerwehr. Ma Vater tät me totschlagen. I bin doch ka Lump, höchstens a rechter Schafseggel.“
Nun war auch das geklärt.
Beide fuhren bester Laune die ganze Nacht mit dem Zug von dem nördlichen Teil Deutschlands in den südlichen. Spät mittags kamen sie in Offenburg an.
„Legio Patria Nostra“ (Die Legion ist unsere Heimat) stand an der Wand der Rekrutierungsstelle.
Die Tür ging auf.
Arthur wurde von einem Arzt hereingebeten.
Die Tür ging zu.
Der Capitaine, ein ergrauter älterer Mann mit selbigem, langen Vollbart, einer Nickelbrille auf der Nase und mit einem Kepi auf dem Kopf sprach im guten Deutsch, mit elsässischem Dialekt, während er die Untersuchung durchführte: „Setzen Sie sich bitte. Sie wollen Legionär werden? Der Legion dienen? Warum?“.
Kurze Pause.
Dabei sortierte er nebenbei irgendwelche medizinischen Bestecke an einem Seitentisch, um dann fortzufahren: „Ich nenne Ihnen die allgemeinen Aufnahmebedingungen, wie sie seit dem 10. März 1831 festgelegt wurden und bis heute ihre Gültigkeit behielten. Sie haben eine Geburtsurkunde und ein Führungszeugnis bei sich?“
Arthur verdutzt: „Nein, nur meinen Ausweis, ich wusste nichts von einer Geburtsurkunde und einem Führungszeugnis“.
„Na, macht auch nichts. Sie sind über 17 Jahre und noch keine 40, wie ich sehe. Über 155 cm sind Sie auch und bei guter Statur. Sind Sie nicht heimatverbunden, was ist der Grund, dass Sie sich für die Waffe oder den Spaten entscheiden? Sie wissen doch sicherlich, dass die Legion wesentlich an Infrastrukturprojekten beteiligt ist. Zu gut deutsch: Die Legion kennt nicht nur die Waffe in der Hand, sondern muss auch ran, Straßen, Gleisarbeiten, Flugplätze, Kasernen, Bunker zu bauen, wir bauen alles selbst. Wir haben keine Philipp Holzmann AG wie in Deutschland, die mal schnell im Auftrag des Staates eure zusammengeschossenen Militäranlagen wieder auf Vordermann bringen“.
Arthur druckte ein wenig leise murmelnd herum: „Philipp, was? Kenn ich nicht. Heimatverbundenheit? Was ist das? Die Heimat, welche ich kenne, gibt es nicht mehr“, nun schon lauter und deutlicher: „die verhassten Bolschewiken haben uns doch alles genommen, meinen Vater getötet und uns vertrieben. In Deutschland fühle ich mich auch nicht wohl und ich möchte noch etwas erleben. Mit der Waffe kann ich auch umgehen, bei der Wehrmacht war ich in einer Spezialeinh...“.
Der Capitaine unterbrach: „Genug. Das sagen sie alle, dass sie bei einer Spezialeinheit der Waffen-SS, bei den Pionieren oder den Fallschirmjägern waren. Wir hatten das schon einmal nach der russischen Revolution, als fast jeder, ein Adliger oder Offizier im ehemaligen Dienste des Zaren, sich bei uns meldete. Was mir besser gefällt und uns nützlicher erscheint als ihr Geschwindel, ist der Hass gegen den Bolschewiken, den Kommunismus. Hiermit können wir reichlich dienen, eure angebliche Waffenkunde werden unsere erfahrenen Ausbilder schnell herausfinden. Und merken Sie sich eins, wenn sie die fünf Jahre Legionszeit überlebt haben. Wer einmal Legionär war, bleibt immer ein Legionär“.
Ein weiterer, jüngerer Uniformierter, mit Brenngläsern von einer Brille auf seinem Echsengesicht, legte breit grinsend einen Kontrakt zur Unterschrift vor. Kurzes Schweigen. Die „Echse“, fragte Arthur: „Sie sind hier als Freiwilliger und unterschreiben aus freien Stücken. Haben Sie mich verstanden? Ich wiederhole es noch einmal: Sie sind freiwillig hier und wollen den Vertrag über fünf Jahre unterschreiben? Wenn nicht, dann dürfen Sie zu dieser Tür hinaus, aus der Sie eingetreten sind.
Arthur überlegte nicht lange, unterschrieb bei seinem neuen Arbeitgeber für fünf Jahre und die Sache war perfekt.
Ein Billet brachte die Abenteurer nach Marseille an der Côte d'Azur.
Im Hafengelände angekommen, mussten sie sich im ausgewiesenen Fort ‚St. Nicola‘ melden. Auf Schusters Rappen ging es vom Hafengelände hinauf auf die Anhöhe zur weit sichtbaren Festung. Marseille ist eine Hafenstadt.
Sie unterscheidet sich kaum von Bremerhaven, Hamburg, Mariupol oder einer sonstigen bekannten Hafenstadt auf der Welt.
Gemischte Nationalitäten, rostige Transportpötte, überfüllte Fähren, keuchende Schlepper, riesige Krananlagen, fluchende Hafenarbeiter, hektischer Straßenverkehr, an der Bar tratschende, fettleibige Nutten, besoffene, herumlungernde Freier in billigen, zerknitterten Anzügen. Arthur fühlte sich wie zu Hause in Mariupol. Der Dreck in den Seitenstraßen stapelte sich in die Höhe. Eine stinkende Brühe in verstopften Entwässerungskandeln staute vor sich her, dass selbst die LKW’s einen Bogen darum fuhren. Nicht etwa aus Höflichkeit gegenüber den Passanten auf dem Trottoir, sondern aus Angst, nach Feierabend das Fahrzeug der Firma säubern zu müssen.
Weiter ging es an vorbeihuschenden Ratten, die zerrend nach dem Wohlstandsmüll der zweibeinigen Evolution, von dem hier reichlich auf die Straßen gekippt wurde, laut quietschend stritten.
Die feilschenden Händler, woher auch immer diese Gesichtsgrimassen kamen, gestikulierten mit schnatternden Hausfrauen. Kläffende, streunende Hunde und schreiende Kinder rundeten das Bild einer zivilisierten Großstadt ab.
Trotzdem hatte es den dekadenten Geschmack nach ergiebiger Maßlosigkeit gefüllter Bäuche und der umnebelnde Dunstschleier von Alkohol schlich sich in willige, labile Köpfe ein.
Nun standen sie am Eingang des Forts bei der Anmeldung und wurden rigoros angehalten. Senegalneger, schwarz wie die Nacht und groß wie Bäume standen Wache, sahen gelangweilt die Papiere an, während sie die herumfliegenden Mücken vor ihren Gesichtern verscheuchten. Murmelten in einer fremd anmutenden Sprache untereinander, plapperten was zu den Aspiranten in schlechtem Französisch und winkten mit einem müden Lächeln zum Weitergehen. Nachdem sie die Wachen passiert hatten, meinte Hendrix, ein Ruhrpottler, welcher sich dem Duo angeschlossen hatte, mit seiner vorlauten Klappe schmunzelnd: „Klar doch, was für eine Gerechtigkeit. Hier in Frankreich bewacht und schützt der Neger Frankreichs Eigentum, dafür beschützen wir sie von den Aufständischen in Afrika. Freiheit und Brüderlichkeit. Vive la France. Schaute der Mohr nicht genau unsere Papiere an, habt ihr das gesehen? Ich schwöre euch bei allem, was mir heilig ist, dass der weder lesen noch schreiben kann“.
Nach einer intensiven ärztlichen Untersuchung gab es für unsere Helden sogenannte „Pferdespritzen“. Spezielle medizinische Pharmazie - Hämmer gegen Tropenkrankheiten, welche schwer verträglich waren. Acht Tage quälten sich die angehenden Rekruten mehr schlecht als recht umeinander.
Heißa Nordafrika
Algerien wurde seit 1848 als absoluter Bestandteil Frankreichs angesehen und so war es in der Verfassung geregelt. Unterteilt wurde Algerien in drei Departements: Algier, Oran und Constantine. Die Zahl der europäischen Siedler, den sogenannten „Pieds Noirs“ (Schwarzfüßler) lag bei über einer Million. Bessere oder fanatischere, französische Patrioten als die Franzosen in Frankreich selbst. So ging es mit dem Schiff am 1. November 1951 nach Oran.
Die Küstenstadt Oran (Arab. Wahran) ist nach Algier die zweitgrößte Stadt und zählte seinerzeit um die 350.000 Einwohner. Der Schriftsteller Albert Camus oder der geniale Musiker Maurice el Medioni, ein Meister der orientalischen Pianomusik, wie auch der avantgardistische Modeschöpfer Yves Saint Laurent wurden hier oder in unmittelbarer Nähe geboren und verbrachten ihre Kindheit in dieser Stadt.
In der Küstenstadt Oran wurden die Neuankömmlinge ihrer Ausbildungsabteilung zugeteilt und die militärische Ausbildung begann.
Eine Metropole für Handel und Industrie. Weinanbau wurde in dieser Gegend viel und gut praktiziert. Es war auch sonst eine ganz ansehnliche Gegend. Die Unterbringung erfolgte fürs Erste im Fort von Mascara. Glücklicherweise wurden die drei Kumpels in die gleiche Unterkunft eingeteilt. Blitzblanke Räumlichkeiten beherbergte die Kaserne und in den Zimmern waren Dreier-Etagenbetten. 30 Mann teilten sich einen Raum. Doch kamen nach kurzer Zeit ungebetene Gäste wie Wanzen, Asseln oder Ameisen, um sich für die Räume zu empfehlen.
Viele nahmen es mit dem Waschen und der Körperhygiene auch nicht so genau. Waren es doch bunt zusammengewürfelte, junge Männer aus aller Herren Länder und allen Schichten der Gesellschaft. Mit Sicherheit nicht immer die Cremé de la Cremé des Homo sapiens. Die Rekruten lausten und kratzten sich lieber halb wund, als dass sie es mal mit einem ordentlichen Waschlappen versuchen würden. Hendrix, Erwin und Arthur fanden das ebenfalls nicht sonderlich störend und betrieben ebenfalls nur Katzenwäsche. Hauptsache, die Frisur stimmte und das Duftwässerchen wie auch die Pomade durfte nicht ausgehen.
Der Chef de chambrè – Zimmerkommandant, bekam diesen Zustand ziemlich schnell mit, ließ alle zum Appell antreten und: „Eine Sauerei ist das. Wascht ihr euch dreckigen Schweine denn überhaupt nicht oder warum seid ihr so verwanzt und verlaust? Ihr kratzt euch doch nur noch wie die Affen. Ab sofort erscheint jeder „Blaue“ persönlich nackend bei mir und zeigt, ob er seine Körperteile samt Gehänge ordentlich gewaschen hat. Nicht nur euren dämlichen Schädel unter die Dusche stecken! Kapiert? Wenn ich eine gottverdammte, alte arabische Hure wäre, dann würde ich euch zum Teufel jagen. Eine Schande für die ganze Legion ist dieser Sauhaufen. Hendrix, was gibt es da zu feixen? Vortreten“. „Mon Chef, mit was denn? Schrubber habe ich keine gesehen?“ Erwin ging wacker einen Schritt vor neben Hendrix: „Oimer, Oimer wir brauchet Oimer.“ Und schließlich stand noch Arthur neben seine Busenfreunde: „Ein scharfes Mittel wäre auch nicht schlecht, damit es hier schön glänzt und fein duftet.“
Die Gesichtsfarbe vom Chef de chambrè verfärbte sich gefährlich in verschiedene Rotvariationen: „Mit Zahnbürsten und euren Nuttendieseln könnt ihr vorlauten Trottel dem Ungeziefer zu Leibe rücken. Was glaubt ihr blauen Säcke denn, wo ihr seid? Euch werde ich Beine machen. Ich werde zusehen, dass ihr drei Deppen in dem Chaotenhaufen vom zweiten Zug landet. Zu denen passt ihr. Alles Großmäuler, Intellektuelle, Besserwisser und sonstiger Abschaum, den ich hier gar nicht mag“. Hendrix stramm fragend: „Mon Chef,
ist das ein Befehl?“. „Nein, für euch dreien eine handfeste Beleidigung. Und die Zimmer werden noch heute auf Hochglanz poliert. Abtreten!“.
Die harte Ausbildung begann, die Tage vergingen und das Legionärsleben mit seinen Freigängen war zu einer feinen Sache geworden.
Im Offizierscasino `Popote´ konnten sich Hendrix und Arthur als Serveur oder Küchenschabe noch ein paar feine Franc zu ihrem Sold hinzuverdienen, bevor es zur Nachtruhe ging. Fleißige, zuvorkommende Bedienungen suchte der Club immer. Sauber eingekleidet mit weißem Sakko, weißem Hemd, schwarzer Fliege und schwarzer Hose, so buhlten die zwei um trinkfeste Kunden.
Bei einer der vielen abendlichen Losungen erwarteten die Rekruten die allgemein bekannte und beliebte Losung „Le ra semble ment pour la duche“, (Antreten zum Duschen gehen). Jedoch an diesem Tag wurden die Jungs gefragt: „pur la parachutiste?“ Hendrix, Erwin und Arthurs Französisch, wie übrigens bei den meisten anderen auch, war ja nicht zum Besten und so meldeten sie sich mit einigen anderen sogleich recht zackig beim Vorgesetzten.
Durch ein Missverständnis landeten sie schließlich bei den Fallschirmjägern, den Parachutists, abgekürzt Paras.
300 km östlich von der Hauptstadt Algier und in 1.100 m Höhe, im kalten, schneebedeckten Atlasgebirge, da lag Sétif, das Ausbildungszentrum der Paras, dem 3.BEP. Zwischen dem Kabylei und dem Atlasgebirge. Es war schon Ende Januar und die Temperaturen glichen ähnlich denen der winterlichen, mitteleuropäischen Alpen, was hieß, dass es fürchterlich kalt war. Eigentlich wollten sie ja keine Gebirgsjäger werden und so klapperten die Rekruten mit blauen Lippen im Freien ihre Runden ab. Was nun folgte, war die knallharte Ausbildung als Fallschirmjäger. Aufstehen um 5:00 Uhr. Im Schnee wurde Sport betrieben. Alles wurde im Laufschritt und freiem Oberkörper verrichtet. Auch das Frühstück, den Kaffee holen, die Ölsardinen und das Brot.
Alles musste schnell von statten gehen. Schnell Ölsardinen hinunterschaufeln, schnell heißen Kaffee in sich hineinschütten, danach der Befehl zum Umziehen. Schnell natürlich. Soldaten muss man in Bewegung halten, sonst kommen sie auf dumme Gedanken. So die häufige Aussage der Ausbilder. Kommandos knallten jedem ans Ohr. Entweder Arbeitsuniform oder Camouflage. Auch wurden neben dem Kampftraining Pionierarbeiten und Ausbauen von befestigten Unterständen geübt. Im Schlamm Balken und Bretter von einem Eck zum anderen schleppen. Diese aneinander binden, mit Sandsäcken oder eingetränktem Astzeug mit nasser Erde anhäufeln. Auseinanderbinden und wieder zurückschleppen. Der nasse, unangenehm kalte Schlamm drang bis in die letzten körperlichen Falten der Rekruten. Ernst meinte ein Ausbilder: „Männer, ihr werdet vielleicht noch einmal an euren Albert denken, der euch das Schützengräben bauen beigebracht hat, wenn ihr so richtig in der Scheiße sitzt“. Den letzten Schliff und die ersten Sprünge aus den `Tante Ju’s´ und `Dakotas´ wurden vom Flughafen in Tunis ausgeführt und so durften die bis dahin genannten „Blauen Säcke“ endlich das langersehnte Képi Blanc nach einer zeremoniellen Übergabe in Sidi-Bel-Abbès tragen.
Ein gewisser Schlendrian kehrte ein und dumme Gedanken hielten Einzug in gewisse Hirne. Hendrix und Arthur brüteten eine Flucht mit einem großen Schiff in die weite Ferne aus. Dies geschah wie immer in einer Hauruck-Aktion. Der Erwin hatte sich eine kleine Araberin angelacht, die er mit feuchten Augen bezirpste und sich somit von der geplanten Aktion ausklinkte. Die kleine unüberlegte Flucht endete nachts im Lampenlicht der Militärpolizei und im Hafengefängnis. In Sidi-Bel-Abbes wurden die Ausreißer von der Legion nicht gerade ehrenvoll in Empfang genommen. Und vor wem mussten sie Haltung annehmen? Kapitän Robert Caillaud, der auch gleich losdonnerte. „Das Duo Infernale. Arthur Engel, zu blöd zum Flüchten, was?“, grollte ernüchternd Caillauds mächtige Stimme. „Wie konntest du bloß den Blödel Hendrix mitnehmen? Wenn ich euch so anschaue, weiß ich nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Engel, Legionär 2. Klasse, wenn du jetzt noch einen Bauch hättest, ihr würdet wie Dick und Doof aussehen. Mensch Hendrix, steh doch endlich mal gerade und höre mit dem dämlichen Gegrinse auf. Wenn es den Herrschaften in Afrika zu langweilig ist, dann empfehle ich Indochina. Adrenalin pur bis zum sicheren Tod. Meldet euch freiwillig, dann erspart ihr euch die Kompanie-Discipline. Beim Betreten von Indochina ist dann eure Strafe, die ihr in jedem Fall aufgebrummt bekommt, getilgt. Gelöscht. Keinen Eintrag ins `Livret Individuel´. Abtreten“.
Überfahrt Indochina
Wenige Tage später. Die „Pasteur“ passierte das britische Singapore, um weiter nach Saigon zu schippern, um dort einzulaufen.
In Saigon angekommen, verließen Teile der senegalesischen und arabischen Einheiten die „Pasteur“ und es ging zur letzten Etappe in den Golf von Tonkin, nach Halong, wo sie am 10. Juli 1953 in die Bucht einliefen. Die Soldaten staunten nicht schlecht, als 3.000 bizarre Felsformationen vor dem Bug des eleganten Schiffes auftauchten.
Hier in der Bucht von Halong erfolgte die schwerfällige Ausschiffung. Die hohe Bordwand musste man über Strickleitern in die wackeligen Landungsboote vollziehen. Manch einer plumpste dabei ins Wasser oder ins Boot. Immerhin ist nun der offizielle Arrest für Arthur endgültig aufgehoben. An Land angekommen hatten dort die einstigen Passagiere bis zum weiteren Sammeln freien Aufenthalt und Arthur tat sich mit Erwin auf Empfehlung eines erfahren Matrosen gleich mal was richtig Gutes an. Die Kneipen von Hon Gai! Mit einem amerikanischen Militär-LKW ließen sich die frisch gelandeten Legionäre nach Hon Gai fahren, der eigentlichen Hafenstadt bei Halong. Die „Pasteur“ konnte dort am Pier jedoch nicht anlegen, da der Hafen zu flach für dieses riesige Schiff war. Ein frischgezapftes Bier an einer der Bars ließen sie zischen und prosteten sich dabei zu. „Auf Indochina!“ Da sie im Freien an der Straße saßen, wurden sie gleich von den vielen Ritschkafahrern mit eindeutigen Handbewegungen und einem „Bum, bum“ animiert, ihren Gemütszustand in Wallung zu versetzen. Hierfür benötigte „Mann“ keinen Dolmetscher. Die bekannte Gestik, flaches Handklopfen auf die Faust und das „Bum, bum“ ist so international wie das berühmte „Vogelzeigen“, Zeigefinger gegen den Kopf. Schon saßen sie auf der Bank einer Ritschka und der empfohlene Massagesalon des Ritschkafahrers war ihr anvisiertes Ziel. Der Preis wurde bei einer etwas molligen, dafür aber laut schnatternden Empfangsmätresse ausgehandelt und die Kameraden tauchten in abgedunkelte Räumlichkeiten ein. Der Geruch von Zedernholz, flackerndem Kerzenlicht und duftenden Räucherstäbchen intensivierte die Stimmung auf das zu erwartende Unbekannte. Vom Ventilator leise aneinander touchierende Bambusrohre, welche von den Decken hingen, gaben eine beruhigende, akustische Umrahmung. Zwei hübsche, spärlich bekleidete Vietnamesinnen nahmen die Staunenden in Empfang und es erfolgte nach dem Entkleiden eine intensive Reinigung des Körpers durch Duschen mit wechselwarmem Wasser. Selbst brauchte man nicht Hand anlegen, denn die zierlichen Damen erledigten dies nach einem eingespielten Ritual. Den Körper heftig einwässern, mit verschiedenen Schwämmen abseifen, abschrubben mit einer Bürste, abwässern und wohltuendes Abtrocknen. Das Gekichere und Geschnattere der Damen lässt vermuten, dass sie sich über die beiden Legionäre köstlich amüsierten.
Erwin und Arthur wurden je in abgetrennte Räumlichkeiten gebeten. Arthur reckte sich zufrieden. Nach diesem angenehmen, erfrischenden Akt zeigte Arthurs Auserkorene auf die am Boden befindliche Massagematte. Auf dieser war ein sauberes Handtuch ausgebreitet, um den geplagten Neuankömmling von oben bis unten mit warmem Öl einzubalsamieren, so dass die Haut weich und geschmeidig wurde. Die filigran wirkende Masseuse ging da schon ganz schön zur Sache und nicht nur die Knochen wurden da einem ordentlich verbogen. An dem Geächzte und Gestöhne von Erwin entnahm Arthur, dass es ihm genauso ging wie ihm selber, so gut wie seit langem nicht mehr. Zum Schluss rieben fleißige Hände den Körper mit warmen Tüchern ab, um die Reste vom Öl zu entfernen, damit es beim Tragen der Kleider nicht unangenehm klebte. Als die Kameraden beim Abschlusstee beisammensaßen, platzte es aus Erwin heraus: „Ja mai Arthur, was war das denn? So was habe ich ja in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, sag doch auch mal was. Du schaust ja wie ein Honigkuchen“. „Ich weiß ja nicht, wie ein Honigkuchen dreinschaut, mir fehlen nur glatt die passenden Worte und die Hose verbeult sich schon wieder“, schmunzelte ein zufriedener Arthur.
Kaum vier Stunden hier und schon eine Erfahrung der besonderen, exotischen Art erlebt. Indochina, ein Traum?
Die Realität fing die beiden geistig Entrückten schnell wieder ein.
Kommandos flogen durch die Luft. Staub, Motorenlärm, das Klacken von Soldatenstiefel erinnerte an den tatsächlichen Zweck ihres Hierseins und der heißt Krieg!
TEIL 2
Operation `Castor´
Am frühen Morgen des 20. November 1953 begann der offizielle Startschuss der Operation `Castor, auf Befehl des 55jährigen General Henri Navarre, dem Oberbefehlshaber von Indochina.
5:45 Uhr: Eine Aufklärungsmaschine, eine C-47 Dakota meldete im Zielgebiet leichten Nebel sowie leichten Nordwind. Mit an Bord einige Hochkaräter wie der für die Operation verantwortliche, einäugige General Gilles, General Dechaux und Bodet. Alle klebten mit der Nase am Fensterchen des Fliegers und versuchten, durch die Nebelschwaden den Boden zu erkennen. Sie mussten nun eine Entscheidung treffen, ob nun diese gigantische Fallschirmjägeraktion gestartet wird oder nicht. Gilles, dem sein Camouflage schon fast zu seiner zweiten Haut geworden ist, brummelte vor sich hin, sein grünes Barett nach hinten geschoben. „Merdé, mit dem Nebel. Ob der sich noch verzieht?“
Die Dakota drehte, flog nochmals über das Tal und tatsächlich konnte man Reisfelder, Hütten und Bambushaine durch die aufgerissene Nebelwand erkennen. Gilles machte sich sogleich auf zu dem Funker und schrie, um den Motorenlärm zu übertönen: „Alè Kamerad, funke sofort zu Cogny, dem Befehlshaber Tonkins, Nordvietnams: `Nebel in Auflösung´!
Die Hektik begann.
Daraufhin wurde um 7:20 Uhr grünes Licht für den Abflug der ersten 65 C-47 Dakotas erteilt. Die erste Welle von hochmotivierten 1.500 Paras stand Gewehr bei Fuß.
Es sollte die größte Fallschirmjägerkonzentration des gesamten Indochina- und späteren Vietnamkrieges werden.
In Saigon machte sich Hektik ganz anderer Art breit, als nämlich der französische Konteradmiral Cabanier sich in das Büro der Villa des Oberkommandierenden Navarre führen ließ und ohne große Höflichkeitsfloskeln gleich zum Punkt kam: „Monsieur General Navarre, der Präsident unserer Republik und der Ministerpräsident wollen wissen, ob wir uns angesichts des nun beginnenden Waffenstillstandes in Korea und unseren Erfolgen im Tonkin und der massiven Hilfslieferungen der Chinesen an die Vietminh nun in der günstigen Lage befinden, Giap (milt.OB.Vietminh) einen - sagen wir mal vorsichtig - fairen Waffenstillstand vorzuschlagen? Wir rechnen insgeheim damit, dass nun die Amerikaner hier einspringen werden und wir uns sauber aus der Affäre ziehen können. Somit können wir die Sache Dien Bien Phu erstmals zu den Akten legen. Haben also nochmals Schwein gehabt“.
Peinliche Ruhe.
Navarre blieb gefasst und übergab Cabanier ein Telegramm mit den Worten: „Lesen Sie mal“.
Der Admiral schnappte seine Brille und starrte entsetzt auf das Papier. Mit hochrotem Kopf musste er zur Kenntnis nehmen, dass in wenigen Minuten die ersten zwei Fallschirmjägerbataillone samt einer Pionierkompanie über Dien Bien Phu abspringen werden.
„Lieber Cabanier, glauben Sie mir, wir locken das „Rote Pack“ nach Dien Bien Phu und schlagen es zusammen. Sagen Sie Paris, dass sie sich auf Verhandlungen mit einem Krüppel der Vietminh einstellen können. Wir werden dann die Verhandlungen in Genf diktieren.“
Navarre schien sich seiner Sache sicher zu sein.
„Ihr Wort in Gottes Ohr. Na, das war es wohl mit dem Waffenstillstand. Dann kann ich Ihnen nur noch viel Erfolg wünschen.“
Er schüttelte bleiern Navarre die Hand, drehte sich um und ließ sich von seinem Chauffeur in die nächste Bar fahren.
Dien Bien Phu
Funksprüche wurden von einem hektisch sprechenden Vietminh aufgefangen: „Hier Quang Do. Angriff auf Muong Thanh und Umgebung. Es ist 10:40 Uhr. Überall Parachutisten aus Dakotas. Bombenangriffe von B-26 auf Pfahlbauten. Ich erkenne zwei Landezonen. Erste östlich bei Hong Cum am Fluss, die zweite nordwestlich der alten Landepiste. Es wird leichtes und schweres Material abgeworfen. Die Kampfstärke ist bereits mindestens ein Bataillon, eher zwei. Unsere Bo Doi eröffnen an der alten Landepiste das Feuer auf den Feind“.
Sein Gegenüber brüllte in den Hörer. „Hören Sie, Quang Do. Nicht auf Gegenangriffe einlassen. Zurückziehen. Setzt euch nach Süden ab. Beobachten Sie weiter und geben Sie Informationen an uns weiter.“
Gegen 16:00 Uhr wurde es den Vietminh-Einheiten zu ungemütlich und sie zogen ihre Truppen auf dem rechten Ufer des Flüsschens Nam Youm zusammen, um sich schleunigst nach Süden abzusetzen.
Paris wurde Punkt 12:00 Uhr über ein chiffriertes Telegramm aus Saigon über die begonnene Operation `Castor´ informiert.
Der Einsatz für das 1. BEP erfolgteTags drauf, um 8:00 Uhr unter Major Maurice Guiraud und seinen 675 Mann, davon über die Hälfte Vietnamesen.
Das 5. vietnamesische Para-Bataillon "Bawouan" (5. BPVN) unter Major Leclerc, folgte am Morgen des 22. November.
Ab diesem Tag konnte schon das erste Flugzeug auf einer provisorischen Flugpiste landen. Am Abend der abgeschlossenen Operation `Castor´ befanden sich gelistete 4.560 abgesetzte Kolonialsoldaten und Legionäre in dem Plangebiet. In kürzester Zeit wurde der neue Feldflugplatz ausgebaut, der zweite wieder landetauglich planiert. 49 Stützpunkte wurden in einer Hauruckaktion rund um die Uhr aus dem Boden gestampft.
Theoretisch war die Landepiste nun für jeden Flugzeugtyp geeignet.
Der bisherige und beliebte Operations-Chef von Dien Bien Phu, General Gilles übergab aus gesundheitlichen Gründen an einen neuen Oberbefehlshaber. Ein tragischer Verlust für alle Einheiten, nicht nur für die in Dien Bien Phu. War nicht er es, welcher erfolgreich die Vietminh in Ná Sàn verprügelte und General Giap ihm Achtung zollte?
Allerdings war er durchaus erleichtert, als er diesem zur Super - Ná Sàn montierte Dien Bien Phu – Monster aus der Dakota hinterher winken konnte.
Nun folgte der Einsatz des smarten Kavalleristen Colonel Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castries als Oberbefehlshaber von Dien Bien Phu. Dieser sollte und wollte die Glorie des Kolonialreiches wieder herstellen. De Castries musste wohl einen tadellosen Ruf in den Augen von Navarre genossen haben. Immerhin zog er schon gegen die Deutschen hoch zu Ross mit gezücktem Säbel zu Felde und war einer von Navarre’s Getreuen.
So kam er mit erhobenen Hauptes, kavalleristisch, sportlich adrett gekleidet, am 8. Dezember angeflogen und winkte beim Ausstieg zufrieden auf „Mon Terrain“ herab. Sein Haupt zierte das Käppchen seines ehemaligen Kavallerieregiments, dem roten Calot. Das scharlachrote Tuch des 3. Saphis-Regiments um seinen Hals, ein Reiterstöckchen in der Hand. Kommandant der Ehrenlegion und 16fach ausgezeichnet. Er, der Weltmeister beim Reitturnier 1933 im Grand Palais, mit seinem Pferd „Vol a Vant“ und zwei Jahre später Weltmeister mit „Tenace“ beim Weitsprung, wollte eigentlich eher den irdischen Genüssen frönen als sich in Dien Bien Phu verheizen zu lassen. Beim Rasieren schaute er sich vor dem Abflug nach Dien Bien Phu stehend im Spiegel an und murmelte seinem Spiegelbild zu. „Nun gut. Befehl ist nun mal Befehl und mir ist ja von Navarre versprochen worden, dass die Sache hier nicht sonderlich lange dauern würde. Ein hart geführter Säbelhieb und die Vietminh liegen blutgetränkt im Staube. Hä, hä, das ist gut so. Ja, so mache ich es. Mit den wilden Horden werde ich schon fertig. Mir, de Castries gebührt dann Lob, Beförderung und eine schöne Aufstockung des Salaires. Ich habe nämlich in Paris noch einige beschissene Dinge zu regulieren. Dien Bien Phu kommt mir deshalb gerade recht“.
Allerdings füllte seine Personalakte auch Jugendsünden wie jede Menge Spielschulden, Frauenaffären und nicht bezahlte Saufgelage, was ihn wiederum menschlicher, sympathischer machte. Ein typischer Spruch von ihm lautete. „Was braucht ein Mann von Welt? Ein Pferd unter dem Arsch, ein Feind vor dem Säbel und ein Weib im Bett“.
So verließ er stolz wie Pfau die Maschine. Im Gefolge sein marokkanischer Bursche, der mit rümpfender Nase stolz de Castries Aktentäschchen in weißen Handschuhen trug.
De Castries eigene Porzellanbadewanne sollte folgen.
Weiter im Schlepptau seine adrette, gut proportionierte und grell geschminkte 28jährige Sekretärin Pauline Bourgeade, die von einem grellen Gepfeife der Kolonialsoldaten begrüßt wurde.
Weiter seine rechte Hand Col. Louis Guth, sein Stabschef, der sich schon gerne mal den Flachmann zur Brust nahm.
Verantwortliche, erfahrene Indochinaoffiziere waren gegenüber de Castries eher skeptisch; anscheinend hatte er einmal an einem mobilen Einsatzkommando im Delta einen „Kampfeinsatz“ mitbegleitet. Doch für langgediente Profis des Dschungelkrieges stand fest: Der Aristokrat und ehemalige Kavallerist aus Algerien, de Castries, hatte keinerlei nennenswerte Indochina-Erfahrung!
Ab dem 10. Dezember 1953 wurden die Positionsnamen der befestigten Hügel in den bekannten weiblichen Codenamen umbenannt. Man munkelte, dass die Namen aus de Castries Liebschaften herführten.
Für die Vietminh unter Giap war dieser neue Feldherr ein Fragezeichen, denn man kannte ihn nur aus der Zeit mit den davor geschilderten Ereignissen. Den Spitznamen bei Giaps Stab hatte er aber schnell inne: „Fuchsgesicht“.
Weihnachten in DBP
Mit kleinen, gut getarnten Kommandounternehmen hielt Giap die Franzosen immer wieder so auch am 24. Dezember, bei schlechter Laune. Dazu ein kalter Nieselregen, dem sogenannten `Crachin´, verdarb den Truppen die Stimmung auf Nüsse, Kekse und Glühwein, welcher extra von Hanoi herbeigeflogen wurde. Navarre ist zu der Feierlichkeit angereist, um der Garnison zu zeigen, wie er zu der Truppe stehe. Nicht Cogny, sondern er sei der Chef von allen. De Castries und Navarre besuchten die einzelnen Bataillone auf einer Visite, gaben mal hier, mal da ein mitgebrachtes, feines Fläschchen aus. Einige Kompanien hatten provisorische Christbäume aufgestellt, welche eher skurril und schrill auf den Befestigungen wirkten als weihnachtlich. Aus Bambusrohren zusammengebastelte Weihnachtsbäume, als Lametta musste der überall rumliegende Stacheldraht herhalten und eingefärbte Eierhandgranaten sollten wohl den Zweck von Weihnachtskugeln liebevoll erfüllen.
Aus vielen Palettenbrettern, bunten Fallschirmen wurde neben dem Hauptquartier von den Pionieren der Fremdenlegion ein Baldachin mit einem Altar zusammengebastelt, der von sieben großen Kerzenhaltern mit brennenden Kerzen flankiert wurde. Lange, mystisch anmutende Schatten wurden so gegen die aufgespannten Fallschirme geworfen, welche eine gewisse Spannung unter den Beteiligten aufkommen ließ. Der Eindruck wurde noch durch das große Kruzifix aus Bambushalmen verstärkt, welches sich wie ein Wächter über den Altar schützend stellte.
Ob Schwarzafrikaner, Indochinesen, Europäer und sogar Araber lauschten bei dem wieder eingesetzten, jedoch mildem Nieselregen wie die frommen Schäflein ihrem christlichen Hirten.
Die Gedanken der anwesenden Soldaten verflogen, als nun Navarre, de Castries, sein marokkanischer Bursche und seine Sekretärin auftauchten. Madamè Pauline Bourgeade hatte sich extra sauber rausgeputzt, trug ihrem Chef seine Reitergarde mit schwarzen, ledernen Handschuhen. Knallrote Lippen, grelle, blaue Schminke, extravaganter, tiefausgeschnittener Tarnoverall, zierte die nicht gerade weihnachtlich gestylte, aufreizende Sekretärin. So blickte sie mit verschränkten Armen, Zigarette im Mund, die Reitergarde unter ihrer Achsel geklemmt, etwas entfernt vom Altar, streng auf das Tun des Predigers. Die Legionäre wussten nicht, wohin sie zuerst schauen sollten. Zum Prediger oder zur Sünde.
Das Camp für Faule
Mittlerweile rollte der Nachschub für die Verbände der Vietminh verstärkt weiter. Die Bomber der Franzosen vermehrten ihre Angriffe trotz schlechten Wetters und konnten Straßen und Nachschubwege erheblich beschädigen. Besonders betroffen waren die Strecken entlang der Route 41, zwischen DBP und Hoa Binh am Schwarzen Fluss und der Route 138, zwischen DBP und Yen Boy am Roten Fluss. Den Vietminh juckte das wenig, denn kaum zerstört, wurden sie wieder ruckzuck instand gesetzt und die Versorgung marschierte dann wieder wie gewohnt in eine Richtung, nach Dien Bien Phu. Meistens nachts, bei Nebel auch tagsüber.
Am 15. Januar begab sich Cogny erneut nach Dien Bien Phu, erörterte mit de Castries und den Bataillonschefs die Lage und flog beruhigt wieder zurück. Kaum aus dem Flieger in Hanoi ausgestiegen, hob ihm beim Einstieg in seine neue Limousine, einer CV 15-6 (Gangsterlimousine), ein Journalist der United Press ein Mikrophon unter die Nase. „Herr General. Wie ist die Stimmung in Dien Bien Phu? Wann kommt es zum großen Knall?“.
„Ich wünsche die Auseinandersetzung in Dien Bien Phu baldigst. Die Artillerie der Vietminh, sofern sie ausreichend vorhanden ist, wird uns Schwierigkeiten bereiten, keine Frage, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie relativ schnell zum Schweigen bringen werden. Giap wird in Dien Bien Phu ins Gras beißen und er muss endlich aufhören, hier den großen Strategen zu spielen.“
Der französische Geheimdienst konnte am 19. Januar 1954 feindliche Funkmeldungen abfangen, woraus hervorging, dass schwerpunktmäßig Granaten der Kaliber 105 mm und 81 mm transportiert wurden. In dem Funksalat, das die Abhörspezialisten zu entwirren versuchten, wurde immer wieder der 25. und 26. Januar erwähnt. Tags darauf flatterten in die Kommandozentralen von Hanoi und Saigon Telegramme mit diesen aufgefangenen Funkinformationen herein. Ein sichtlich zufriedener Navarre sprach gut gelaunt zu seinen Offizieren: „Na endlich! Hat das Warten jetzt ein Ende? Jetzt werden wir sehen, ob der Cogny seine Hausaufgaben erfüllt hat. Telegrafieren Sie das gleich weiter an meinen de Castries. Der soll sich schon mal einen Stahlhelm aufsetzen. Jetzt bekommt mein Kavalleriekollege endlich ordentlich was zu tun“.
Am gleichen Tag flog Cogny erneut nach Dien Bien Phu, besprach wieder mit de Castries und den Bataillonschefs die Situation: „Meine Herren. Mittlerweile ist mir durch die Luftaufklärung und den abgefangenen Funkmeldungen eines klar geworden. Giap hat uns fest eingeschlossen und wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Die Katastrophe muss abgewendet werden. Was heißt das im Klartext? Navarre hat zwei Meinungen über Giaps Vorgehensweise. Einer Meinung von Navarre stimme ich nicht zu und zwar, dass Giap Dien Bien Phu nur festnageln möchte, unsere Bataillone dort bindet und er sich in aller Seelenruhe eine strategische Position nach der anderen in Indochina unter den Nagel reißt.
Männer, wenn Sie hier auf die Bilder schauen, stellen Sie fest, dass die Laufgräben der Vietminh sich an unsere Stellungen zum Teil bis auf 100 m herangegraben haben. Für mich ist klar, dass ein Granatangriff als Erstes erfolgen wird. Sei es von Artillerie oder gewaltigen Sprengminen oder einer kombinierten Aktion. Wie auch immer. Sodann wird sich die „Rote Flut“ auf die schwächsten und weit entferntesten Stellungen stürzen. Also `Beatrice´, `Gabrielle´, vielleicht `Isabelle´. Meine Herren, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es hier mit einem Erobertwerden und mit Rückeroberung zu tun haben. Wir haben keinen Raum für große Generalstabspläne. Wir müssen zusehen, dass wir den Feind in unserem beengten Areal so zum Aderlass zwingen, dass er ausblutet.
Warum buddeln denn die Vietminh in Seelenruhe ihre Gräben bis an unsere Stellungen? Alter Junge de Castries, erkläre mir das mal. Und vor allem, warum geht das denn überhaupt? Pennt ihr?“. „Ja, wir unternehmen mit Combateinheiten hier und da Störaktionen und können da auch Erfolge vorweisen. Kaum zerstört, sind dann gleich wieder doppelt so viele Gräben da. Was sollen wir denn tun? Nachts buddeln sie neue Gräben, tagsdrauf schaufeln wir sie zu. Zu greifen bekommen wir die fast nie. Die roten Hunde ziehen sich wie die Maulwürfe zurück, meiden den Kampf. Hetzen wir hinterher, stoßen wir auf gewaltigen Widerstand. So ist das nun mal in Dien Bien Phu. Buddeln und zuschippen. Irgendwann wird ja wohl mal ein Totalangriff folgen. Dann gibt’s Feuer“.
Nach der Besprechung ließ Cogny die Kommandeure mit ihrem Frust alleine und machte sich zurück nach Hanoi.
Saigon
Für Navarre meldete sich noch zu allem Überdruss der Regierungsvertreter aus Paris, Marc Jacquet, für den 25. Januar an. Er und sein mitgereister General Blanc forderten eine gemeinsame Besprechung mit Cogny und ihm.
„Meine Generäle, Paris ist beunruhigt über die Situation in Dien Bien Phu. Korrespondenten aus Schweden, der Schweiz und anderen neutralen Ländern handeln die Kommunisten schon als Gewinner. Wie auch immer das aussehen mag, es schadet Frankreich. Können Sie mir das bitte erörtern? General Navarre, sind Sie sich des Sieges in Dien Bien Phu sicher?“.
Ein Glas Pastis lehnte Jacquet wirsch ab.
Daraufhin Navarre in einem scharfen und überzogenen Ton: „Wir werden die „Roten“ in Dien Bien Phu schon aufhalten und vernichten. Wir haben die Verpflichtung auf uns genommen, Laos zu beschützen und für die Vietminh ist in Dien Bien Phu endgültig Schluss. Unsere Artillerie und Bomber wird sie in tausend Stücke schießen und der Rest wird von unseren Panzern und Einheiten eingekesselt und vernichtet. Unsere Soldaten warten nur darauf, endlich loszuschlagen. Die jungen Männer langweilen sich doch nur in ihren Hängematten und provisorischen Casinos, wo sie zocken. Träumen von vollen, schäumenden Biergläsern, geduschten und parfümierten Weibern. Es ist bald Schluss mit der Träumerei, jetzt muss der Soldat ran. Das Bajonett schleifen, die Waffen laden. Sie werden sehen, wie das flutscht. Die Weiber in Dien Bien Phu machen die doch ganz hirschig. Voran die vollgeschminkte Sekretärin von de Castries, Bourgeade. Von der lässt sich mittlerweile mein de Castries im Camp spazieren fahren. Nicht er selber, sondern sie fährt. In ihren hohen Lederstiefeln und immer eine Wolke Dior-Parfüm hinter sich herziehend, so verdreht sie den Legionären und Fallschirmjägern ihre Schädel. Oder diese billige Zeitungsschmiererin von einer Journalistin Brigitte Friang, deren Zigarettenstummel von den Soldaten wie die Trüffel gesammelt werden, nur weil sich roter Lippenstift darauf befindet. Ist das nicht abstoßend? Dann die Nutten mit ihrem asiatischen Gegrinse in ihren zwei Camp-Bordellen, ja da können sie stundenlang strammstehen, die Herren Legionäre. Dien Bien Phu ist ein Camp für Faule geworden. Es wird Zeit, dass die Soldaten zeigen, was sie auf dem Kasten haben“.
Pause.
Der Parlamentarier wurde rot. „Wenn Sie laut und ordinär hier herumbrüllen, dann kann ich auch anders. Bitte übergeben Sie mir bis morgen eine schriftliche, in militärisch abgefasste Erklärung über ihre Einschätzung, die ich mir dann in Ruhe zu Gemüte führen kann. Im Übrigen werden wir Dien Bien Phu am 26. Januar gemeinsam inspizieren“.
Gegen 13:50 Uhr landete in DBP eine Dakota mit hohem Besuch. Der Parlamentarier Jacquet, Luftwaffencolonel Dejean sowie der aus Frankreich mitgereiste General Blanc und die Streithähne Navarre und Cogny.
In einer Jeepkolonne wurden die Stellungen angefahren. Piroth, der korpulente einarmige Artilleriechef mit seinem runden Gesicht verbreitete gutgelaunten Optimismus wie immer. „Meine Herren, mit meinen 155ern Steilfeuerbatterien erreiche ich fast jeden Punkt in Indochina, also auch die paar Kanönchen der „Roten“. Schauen Sie sich doch diese Prachtkerle an. Fast wie die schwere Schiffsartillerie“.
„Zeigen Sie mir mal Ihre Aufstellung der Haubitzen, wie viele sind es?“
Dejean schaute auf die Karte mit den Positionen der Batterien und murmelte: „Das ist ja nicht besonders viel für das, dass sie zwei Flugpisten verteidigen wollen. In Hanoi stehen von diesen Dingern doch Hunderte herum, die nicht benutzt werden und sich langweilen. Fordern Sie einen ordentlichen Happen Nachschlag an. Ich gebe sofort grünes Licht“.
„Quatsch, hier meine Feuerleitpläne, ich will die Vietminh mit Granaten in den Himmel schicken und keine Kanonen auf sie werfen. Geschütze habe ich mehr als genug“. Piroths Gesichtsfarbe entwickelte sich, nicht nur bedingt wegen seines zu hohen Blutdrucks, farbig vor Entrüstung.
Hinter den Kulissen
Erneut gerieten Gefangene ins Netz, nicht nur bei Dien Bien Phu, sondern auch in anderen Krisenregionen bei Hanoi und Haiphong. Aus den Verhören konnte ein Angriffsdatum der Vietminh herausgefiltert werden, diese sagten den 25. Januar oder kurz danach voraus. Ein Lauern und ein Warten, doch nichts geschah, der langersehnte Frontalangriff blieb aus.
Saigon
Navarre rief seinen Sekretär in sein Büro: „Schreiben Sie Cogny über die Sache „Xenophon“ wie folgt: Sehr geehrter Herr General Cogny ... usw.... Als ich Sie damals bat, einen Plan für „den Fall der Fälle“ auszuarbeiten, da war die Situation auch noch etwas anders. Nun, nachdem sich Giaps 308. Division in Richtung Laos abgesetzt und beide Angriffstermine, welche von Ihnen genannt wurden, bei Terminen blieb, gehe ich davon aus, dass Giap die Hosen gestrichen voll hat. Natürlich umschreiben Sie das. Die Sache „Xenophon“ ist nun eine Sache für den Papierkorb, mein Lieber. Außerdem denke ich daran, Bataillone abzuziehen, um sie anderweitig einzusetzen. Die Soldaten müssen beschäftigt werden. Das alles ein bisschen mit Pepp geschrieben. Unterzeichnen mit Navarre usw.“.
Paris traute Navarre nicht recht und beorderte den Staatssekretär de Chevignè nach Dien Bien Phu. Er war mit weitreichenden Vollmachten des nationalen Verteidigungsrates ausgestattet und hatte so volle Entscheidungsfreiheit. Mit einem Satz konnte er das Schicksal von Dien Bien Phu besiegeln, das Ausfliegen der Bataillone befehligen, was nun noch möglich wäre.
Chevignè fragte Cogny in der Dakota auf dem Weg nach Dien Bien Phu: „Warum nennen hier alle Dien Bien Phu eigentlich die „Toilettenschüssel“?“. „Na warten Sie ab, wenn wir in die „Toilettenschüssel“ eintauchen werden. Es mieft dort sogar nach einem großen Haufen, eben wie auf der Toilette“, feixte Cogny.
Als die Dakota in die „Toilettenschüssel“ ihre Nase eintauchte, die schwere Nebelsuppe durchschnitt, konnte der Staatssekretär den Begriff verstehen. Zwei Tage schaute sich der Staatssekretär in Dien Bien Phu um, sprach viel und oft mit den Bataillonskommandeuren, saß zu Tisch mit de Castries, trank lecker Schampus und flirtete mit dessen aufreizender Sekretärin.
Cogny blieb nichts anderes übrig, als sich dem „Zivilisten, der keine Ahnung hat“, wie er ihn nannte, hinterher zu dackeln. „Nur peinlich, dieser Zivilist und noch peinlicher ist dieser Galan, der lieber seine Sekretärin Pauline Bourgeode hofierte, als die Belange seiner Soldaten zu hinterfragen“.
Cogny schüttelte nur den Kopf.
In diesen zwei Tagen gab es von den Vietminh keine wesentlichen Störungen und der Staatssekretär flog mit Cogny gut gelaunt zurück nach Hanoi.
Cogny im Gespräch mit dem Verteidigungsminister
16. Februar 1954. In Hanoi bat der französische Verteidigungsminister René Pleven General Cogny zu einem Vieraugengespräch in die Maison de France, um mit ihm zu erläutern, wie man aus dieser Misere ohne großen Gesichtsverlust herauskäme. „Na Cogny, legen Sie mal los, wie ist die Lage in der „Toilettenschüssel?“. Mittlerweise spricht ja schon jede Toilettenfrau von der „Toilettenschüssel“ Dien Bien Phu. Ruhmreich klingt da anders“.
„Herr Verteidigungsminister, die Lage ist nicht rosig, aber auch nicht ausweglos. Vereinfacht gesagt klingt es so: Auf der einen Seite sind unsere besten Bataillone in Dien Bien Phu. Auf der Gegenseite befinden sich Giaps beste Divisionen. Geschätztes Kräfteverhältnis 1:3 gegen uns. Wir haben schwere Artillerie, Panzer und Flugzeuge. Wenn das Wetter mitspielt, dann können wir mit unseren Bombern denen ordentlich einheizen. Wenn wir genügend Flugzeuge ..“.
„Mensch Cogny, ich höre nur wenn, wenn, wenn. Was ist, wenn nicht? Wie sieht es denn dann aus, falls das Wetter uns die Suppe versalzt? Im Mai wird in Genf eine internationale Konferenz über die Asienprobleme gestartet und wir inszenieren womöglich eine Katastrophe.
Die Amerikaner halten sich momentan heraus. Eisenhower sagte wörtlich: Niemand ist mehr gegen das Eingreifen in Indochina als ich“.
„Sie fragten, wenn nicht? Na, dann ist es ganz schlecht. Die Artillerie kann keine Aufklärer in die Luft schicken, ist somit blind, die Bomber bleiben gänzlich weg und der Nachschub aus der Luft wird eingestellt. Aber wir wollen mal nicht alles schwarz malen. Wir arbeiten an Konzepten“.
Pleven außer sich: „Konzepte, ich höre wohl nicht recht. Das erklären Sie mir mal deutlicher“.
Cogny konnte einem René Pleven nichts vormachen. Pleven, ein Mann der ersten Stunde, zog in Afrika mit Leclerc gegen Rommel, leitete unter de Gaulle schon die Exilregierung in London und war zweimal Ministerpräsident.
„Na, was meint denn dein „Freund“ Navarre zu der Situation in Dien Bien Phu“, fragte Pleven jetzt leise, listig und persönlich. „Na, der ist nach einer kurzen Periode der Unsicherheit mittlerweile wieder optimistisch und schmiedet große Offensivpläne. Aus dem fernen Saigon hat er auch den Überblick. Dort kann er mit den Damen aus dem Büffelpark am Ende des Boulevard Galiéni ja diese mitnehmen und sich mit ihnen am Quai de Belgique volllaufen lassen, bevor er auf Staatskosten im Hotel `Continental´ das Bett der Suite mit diesen Nutten verrammelt. Nein, Scherz beiseite, mein Chef Navarre ist voll auf dem Laufenden. Geht ja mittlerweile ganz gut aus der Distanz mit Telefon, Telegramm und Sekretär. Ein Lattre de Tassigny ist er nicht“, schmunzelte hämisch Cogny.
Daraufhin Pleven: „Sind das die Konzepte oder nur ganz miserable Witze? Wir machen Folgendes, die Termine stehen eh schon. Am 19. Februar besichtigen die Amis und wir gemeinsam Dien Bien Phu, vielleicht können wir denen den Schwarzen Peter doch noch über das Meer verscherbeln“.
Eine illustre Runde auf dem Flug nach DBP
Das Gespräch im Flieger über die militärische Situation verebbte nach viel blabla in einem Patt. Das Mittagessen in dem Flieger war gut, der Wein schmeckte und die Stimmung vorzüglich. Der General o’Daniel, ein Meister im Witzeerzählen, forderte die Lachmuskeln aller Beteiligten. Der Dolmetscher musste sein ganzes Können anwenden, um die amerikanische Pointe ins Französische zu übersetzen. Meistens waren es Nettigkeiten über die Kommunisten oder Frauen des horizontalen Gewerbes.
Angetreten zur Begrüßung waren die Fremdenlegionäre des 1. Bataillons der 13. Halbbrigade unter Lt. Capeytron. Mit im Schlepptau jede Menge Pressemenschen.
Einer blieb in Saigon. Der eigentliche militärische Chef von Indochina, Navarre. Er schmollte vor sich her, weil sein Untergebener Cogny ihm die Schau stahl. Pleven lud ihn nicht einmal ein, was für eine Schmach.
De Castries führte die Gesellschaft mit seinem Reiterhütchen auf dem Kopf an. General Ely mit seinem Kepi und den fünf Sternen darauf hinterher. Dann der Verteidigungsminister Pleven mit einem zerzausten Strohhut auf dem Haupt. Er sah eher wie ein Globetrotter statt wie ein Minister aus. Cogny und o’Daniel hörten sich die Erläuterungen von de Castries an. Das Wetter war einwandfrei, die Sonne schien, die Soldaten vertrieben sich die Zeit mit einem Volleyballturnier.
Bataillonskommandant Gaucher erklärte nach der Einleitung von de Castries ausführlich, wie er gedenkt, die Vietminh zu verhauen. Bei geselliger Stimmung wurde in jedem Befehlsstand der Befestigungsanlage zu einem Gläschen Hochprozentigem eingeladen. Die Bataillonskommandeure ließen sich da nicht lumpen, persönlich mit solchen Ehrengästen, bei einem Blitzgewitter der Fotografen anzustoßen.
Von den Vietminh hörte und sah man nichts. Warum sich aufregen, wenn es nichts zum Aufregen gab.
General Fay, Stabschef der Luftwaffe, musste die erwachsenen Leute wieder auf den Boden der Tatsache zurückholen. „Herr Minister, das mit der guten Laune hier ist ja ganz schön. Nur wenn ich mir das so anschaue, wird mir regelrecht schlecht, denn ich weiß, was ich für eine Verantwortung trage. Ich wiederhole mich gerne noch einmal: Navarre soll endlich anfangen, unsere Truppen zu evakuieren. Umso schneller, umso besser für unsere Soldaten. Falls nicht, bedeutet dies das Ende für die französische Präsenz im Tonkin, vielleicht in ganz Indochina“.
Die Stimmung geriet auf einen eisigen Nullpunkt. Die anwesenden Bataillonskommandeure, der Verteidigungsminister, de Castries starrten überall hin, nur nicht zu Fay. Cogny zündete sich einen Glimmstängel an, zuckte mit den Schultern, als wolle er sagen „Sag ich doch“.
o’Daniel, der ein wenig abseits mit dem geselligen Piroth locker an einem Geschütz lehnend, einen fetten „Jack Daniels“ vernichtete, verstand kein Wort, der Übersetzer wollte nicht übersetzen.
„Mensch Fay, die Soldaten sind alle guter Dinge, großartige Männer und wollen, dass der Vietminh endlich angreift. Ich spüre es, aber ich wünsche es nicht!“. „Ich auch nicht, mon Präsident“.
Abflug nach Hanoi. Als Navarre von den Äußerungen des Stabschefs der Luftwaffe erfuhr, bekam er einen Tobsuchtsanfall und schrieb an Fay. „Ich habe Dien Bien Phu ausgewählt, weil wir nur dort siegen können. Was glaubt denn ein Flieger wie Sie eigentlich, wer er ist? Ich habe hier monatelang die Situation prüfen lassen und ich betone nochmals in Kenntnis aller meiner Informationen. In Dien Bien Phu werden wir siegen!“.
Die eigentliche Garnison Dien Bien Phu glich eher einer Enklave auf einem anderen Stern. Alles wurde herbeigeschafft und verbaut. Ein künstlich aufgeblähtes Gebilde mit eigenen Regeln, Feldlazaretten, Militärpolizei, verschiedene Versorgungszentren und zwei Bordelle (BMC Bordells Mobiles de Campagne – Mobile Feldbordelle). Die Nutten waren ein Mitbringsel aus Nordafrika und einige Asiatinnen wussten auch, wo der Piaster locker saß.
Eine Ansammlung von Nationalvietnamesen und einer Multikultitruppe, bestehend aus 17 Nationen, blickten aus ihren kleinen Anhöhen auf die hohen Berge nicht weit von ihnen hinauf.
Für die Versorgung der Soldaten wurde bestmöglichst gesorgt.
Da die Kolonialarmee aus allen möglichen Kulturebenen bestand, war dies eine logistische Meisterleistung der Proviantlogistik.
Auf der einen Seite waren die Europäer, welche gerne einen zur Brust nahmen. Hierfür glich die Alkoholauswahl schon der einer gut sortierten, gehobenen Bar. Von verschiedenen Hochprozentigen über mehrere Sorten Bier, einer schönen Auswahl französischem Wein bis hin zum edlen Champagner, war so alles vertreten, was Rang und Namen hatte. Vinogel, ein Pulvergemisch mit Wasser vermengt, sollte einen Wein vorgaukeln. Doch diese rote Brühe tranken nur die Hartgesottenen. Ein Zeug höchstens für den Notfall.
Für die Franzosen war es schon fast eine Zeremonie, dass man das Essen mit einem Aperitif begann und eine Flasche guten Weines durfte auf dem Tische ebenso wenig fehlen wie der Digestif als Abschluss.
Die deutschen Legionäre tranken lieber ein gekühltes Bier zum Essen, vor allem die Bayern und die aus dem Norden. Die Badenser, Württemberger und Franken nahmen vorlieb mit ihrem Schorle oder Gespritzten. Das Essen war den deutschsprachigen weitgehend egal, Hauptsache ein Fleischgericht, dazu Kartoffeln oder Nudeln mit Soße.
Bei den Arabern musste besonders darauf geachtet werden, dass nicht versehentlich Schweinefleisch geliefert wurde, denn dies wurde leicht als provozierende Beleidigung angesehen und der eigene Mufti konnte da schon mal die Massen zu einem Aufstand mobilisieren. Hirse und Harissa standen auf der Wunschliste genauso wie Feigen, Datteln und honigsüßes Gebäck.
Am interessantesten waren die Senegalesen, bei denen es kunterbunt zuging. Denn die bestanden aus Christen, Moslems und Mischreligionen. Fremdanmutende Gebetszeremonien und farbenfrohe Feiern boten ein fremdartiges und abwechslungsreiches Schauspiel. Senegalesen gibt es in dem Sinne ja nicht, denn die eigentlichen Völker leben landesübergreifend. Sie bestanden aus einzelnen Stämmen wie die Wolof, Djolas, Mandingo, Serathuli, Toucoleuir, Soninkè oder Fulbe, um nur einige zu nennen. Ein jedes Volk hat eine komplett eigene Sprache und die Verständigung untereinander wurde mehr recht als schlecht in Französisch gehalten.
13. März 1954
Ein Morgen der Routine erweckte die Garnison des Tales in gewohnter Betriebsamkeit. Das Wetter war gut, die Sonne schien, ein schöner Tag zum Sterben.
Doch gegen 8:30 Uhr gab es Hektik in der Garnison, als eine Maschine vom Typ „C-46 Curtiss Commando“ landete. Sie hatte einige Kampfnarben von Viet-Flakgeschossen abbekommen. Danach landeten noch zwei „Dakotas“. Diese zierten ebenfalls Blessuren mit Einschusslöchern an den Tragflächen. Unangenehm bezeichnend.
Zur Pastiszeit, kurz nach 15:00 Uhr, landete eine weitere „Dakota“ mit zwei Bekannten. Die Reporter André Lebon und Jean Martinoff hatten nach Dien Bien Bien Phu Sehnsucht und machten sich nach `Huguette´ zu den Legionären des 1. Bataillon vom 2. R.E.I. auf. Sie wollten einen kleinen Smalltalk mit dem Kommandierenden Clémencon führen.
17:00 Uhr
Die Symphonie des Todes leitete eine Ouvertüre mit einem gewaltigen Paukenschlag ein, durch das brachiale Inferno von insgesamt 9.000 Granaten aus den Geschützen der umliegenden Anhöhen auf die völlig geschockten Einheiten der Trikolore ein. Abgesehen hatten es die Vietminh-Artilleristen der schweren 351. Division vor allem auf die Stellungen von Madame `Beatrice´ (und `Gabrielle´. Das Granatfeuer kam aus Richtung der Hügel 633, 674 und 701. Doch auch `Isabelle´, `Dominique´ und `Eliane´ wurden nicht geschont und getroffen. Kurzfristig hielt man es für eigenes, versehentliches Feuer, bis man eines Besseren belehrt wurde.
Hanoi
Ein Anruf von Dien Bien Phu nach Hanoi:
„Cogny, Cogny es geht los, wir liegen flächendeckend unter schwerem Artilleriebeschuss, ich erwarte jeden Moment einen Sturmangriff von den Kommunisten“, de Castries war außer sich. Seine Stimme zitterte förmlich vor Aufregung.
„Alter Junge, das ist der Beginn, du wirst es schon schaukeln. Zieh dir einen Helm auf und zieh den Kopf ein“.
Cogny blieb ruhig, schenkte den Cognacschwenker voll, nahm davon einen Schluck und grübelte in seinem abgedunkelten Büro bei einer kubanischen Zigarre vor sich hin. In seinen vier Wänden saß er da, nur die Schreibtischlampe brannte. Er wartete auf neue Hiobsbotschaften.
Um 2:25 Uhr erreichte Cogny ein weiterer Anruf aus DBP: „`Beatrice´ gefallen. Gaucher, Pègot, fast der ganze Stab, ausgelöscht, tot.
Hanoi/Saigon
Kurze Zeit später stellte Cogny’s Sekretär ein Gespräch zu seinem Chef durch.
Navarre legte von Saigon arrogant und überheblich los: „Cogny, was ist denn dort los, in Dien Bien Phu? Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Rote Flagge bereits auf `Gabrielle´ wehe. Na guten Morgen. Ich werde genervt von Paris. Fast ständig klingelt das Telefon und es rasselt unaufhörlich das Telex. Man könnte meinen, die Sesselfurzer von Politikern sind besser informiert als wir. Wissen Sie, was die Schmierfinken von Journalisten Bodard und Clos schreiben? Nein? Dien Bien Phu sei eine Mausefalle. Sie sind verantwortlich. Ich erwarte, dass Sie erfolgreiche Gegenmaßnahmen ergreifen. Also, mein Cogny, in einem sind wir uns ja bisher immer einig gewesen. Gegenüber Paris erst mal Klappe halten. Ich hatte dieses Desaster ja befürchtet. Diese Chinesen mit ihren Hilfslieferungen soll doch der Teufel holen. Diesen lächerlichen Geschichtslehrer von Giap mit seinem kommunistischen Geschmeiß, mit dem wäre ich schon fertig geworden. Und unsere feine Pinkel von Politiker. Ihren Wams haben sie sich bei uns überall vollgeschlagen, mich in eine ausweglose Situation bugsiert. Aber die Mittel, die ich zusätzlich angefordert habe, da rücken sie keinen lächerlichen Piaster heraus. Voran dieser Ministerpräsident von Laniel, unter der Hand sprach er mir in Paris Unterstützung zu und jetzt weiß er nichts mehr davon. Von wegen „eine Hand wäscht die andere“. Wissen Sie Cogny, dieser Laniel ist nicht irgendeiner oder irgendjemand. Nein, er ist ein gar nichts.
Die Amis lachen sich über uns halbtot. Politiker sind eben keine Soldaten. Sollen sie doch den Mist selber ausbaden.“
Cogny plärrte in den Hörer zurück: „Ich höre mir ihre Ansichten an, kann sie aber weder verstehen noch in irgendeiner Form unterstützen, ich weiß gar nicht, was sie wollen“. Eine Verbalattacke kam von der anderen Seite.
Cogny ließ nun in seinem Büro lautstark seinem Frust vor den Offizieren freien Lauf: „Wenn ich diesen inkompetenten Idioten Navarre zu fassen bekomme, dem haue ich den Frack voll“.
16. März 1954
Lagebesprechung in Hanoi
Maj. Bigeard wurde von Cogny nach Hanoi in sein Büro gebeten, um seine Meinung zu hören, warum und weshalb in kürzester Zeit zwei starke Verteidigungsstellungen in Dien Bien Phu von Giaps Vietminh im Sturm überrannt worden sind. Cogny nahm auch kein Blatt vor den Mund und legte, kaum war Bigeard eingetreten, nervös und lautstark los: „Mensch Bruno, das läuft wohl überhaupt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Viets haben uns ja völlig überrascht. `Beatrice´ und `Gabrielle´ sind gefallen. Zwei starke Befestigungen. Na prost Mahlzeit. Zwei gute Bataillone vernichtet. Unsere Artillerie absolut uneffektiv. Von Paris und Saigon aus betrachtet wird die Schlacht in Dien Bien Phu schlecht geführt. Nicht einen einzigen Erfolg kann der Reitweltmeister de Castries in Dien Bien Phu aufweisen. Die gesamten Gegenangriffe taugen nichts. Giap macht, was er will. Und nun? Erklären Sie mir mal, wie dieser de Castries gedenkt, vorzugehen? Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt mal zu dir Bruno, was machen denn deine Paras vom 6. Bataillon? Nimm deine Paras, hau ab nach Dien Bien Phu und räum den Laden auf!“.
Die düsteren Ereignisse in Dien Bien Phu reflektierten die Stimmung im Hauptquartier hier in Hanoi. Dominant war nur der Zigarettenqualm im halbdunklen Besprechungsraum.
Cogny weiter: „Was glauben Sie denn, wie die Stimmung in Dien Bien Phu ist? Die Legionäre der 13. und die Algerier vernichtet. Pieroth, der Idiot, verübte Suizid. Mit einer Granate hat er sich in die Luft gejagt. Dann die Geheimhaltung um seinen Tod, obwohl es längst die Spatzen von den Dächern oder Pagoden pfeifen. Wohl ein Patzer beim Funkverkehr passiert? Ja, kann er die Handgranate nicht auf die Vietminh werfen? Mein lieber Bruno, wir müssen uns da schleunigst was einfallen lassen. Du bist der Richtige. Para Nombre 1“.
Von den anderen Offizieren hörte man nicht ein einziges Sterbenswörtchen. Aus Bigeard platzte es heraus: „Ich habe gehört, dass die Bataillonschefs im Hauptquartier von Dien Bien Phu intern de Castries schwer kritisieren. Col. Langlais hat schlechte Laune, da es ihm nicht gelungen war, mit seinen Einheiten die Vietminh effektiv zu bekämpfen. Von de Castries bekam er nicht die gewünschte Unterstützung. Einigeln sein Motto. Sind wir Paras oder Soldaten für den Schützengraben? Allgemein wird bemängelt, dass die Abstimmung untereinander nicht optimal ist. De Castries fehlt das Zeug zu einer professionellen Führung. Sein Chef der Organisation Col. Lt. Keller ist übermüdet und säuft „verbleiten“ Kaffee wie Wasser. Er sitzt im Hauptquartier auf dem Boden und nimmt seinen Stahlhelm nicht mehr ab. De Castries vergräbt sich in seinem Bunker, hat keinen Mumm in seinen Knochen und lässt sich auf dem Feld nicht mehr blicken. Ich denke, dass er überhaupt keinen Überblick mehr hat. Die Landebahn wird pausenlos beschossen und die Flugabwehr der Vietminh wird immer präziser. Die Verwundeten können jetzt schon nicht mehr sicher ausgeflogen werden, geschweige denn in den Feldlazaretten ordentlich versorgt werden. Ich habe da meine Informationen von Langlais“.
Pause und langer Zigarettenzug.
„Ja mein lieber Bruno, ich sehe, Sie machen sich ernsthafte Gedanken, dann unternehmen Sie doch was, um die Befestigung in Schwung zu bekommen. Sind Sie Fallschirmjäger oder Kavallerist?“
Frz. Regierungssitz in Hanoi:
Konsul Sturm ließ ein geheimes Telegramm zum US-Botschafter verschicken, der sich gerade im Gespräch über eine mögliche Evakuierung aller weiblichen Amerikaner von Hanoi nach Saigon befand.
„Kein Ziel ist mehr in Hanoi und Umgebung sicher. Egal, ob zivile oder militärische Einrichtungen. Die Partisanen greifen sporadisch überall an, um den Nachschub nach Dien Bien Phu zu stören. Besonders betroffen ist die Straße Hanoi – Haiphong. Für den Verkehr ist die Verbindung nur noch nachmittags offen. Die Eisenbahnstrecke wurde schlimm sabotiert, 12 Züge wurden zerstört. Gestern kamen lediglich drei Züge an. Die Infiltration von Vietminh in die noch loyalen Truppen nimmt ständig zu. Die Franzosen denken bereits nach, wie sie sämtliche Kinder und Frauen nach einem Fall von Dien Bien Phu von Tonkin nach Saigon evakuieren können“.
31. März/ 01.April Hanoi
Navarre landete nachts um 1:15 Uhr in Hanoi und wurde von der Dakota nicht von Cogny, sondern von Oberst Bastiani mit einem Regenschirm, der Schutz gegen den starken Regen bieten sollte, abgeholt. „General Cogny ist müde, er lässt sich entschuldigen“. Navarre war sauer. Bastiani war für ihn der gleiche Bösewicht wie Cogny. Er diente unter Cogny und dieser Mensch holte ihn nun wie ein Reisender 2. Klasse ab. Nicht der Chef persönlich. Eine unerträgliche Demütigung. Ein Fauxpas.
Tags drauf, 7:45 Uhr, knallte Navarre die Tür zu Cognys Büro auf und wetterte, ohne sich zu setzen, mit nicht gerade militärischen Höflichkeitsfloskeln los: „Was soll denn der ganze Scheiß? Die Kampfmoral der Soldaten muss gehoben werden. Sie kämpfen schließlich für die Ehre Frankreichs. Das Zentrum, die Landebahn und `Isabelle´ müssen in jedem Fall gehalten werden, wenn wir einen geordneten Ausbruchversuch unternehmen müssen. Keinen Meter zurück. Halten und keinen Meter zurück. Halten! Verstehen Sie mich? Ja, tun Sie was, Cogny. Missbrauchen Sie nicht das Vertrauen Frankreichs. Verstärkungen genehmige ich nur noch, wenn ein Sieg garantiert ist. Das muss doch Ihr dicker Schädel kapieren“.
Langsam erfüllte eine nervöse Ruhe den Raum.
Cogny, locker in seinem Sessel qualmend, beobachtete Navarre, der wie ein aufgescheuchter Gockel im Stechschritt auf und ab schritt: „Diese Sprüche kenne ich doch von irgendwoher, ...halten und keinen Meter zurück..., waren allerdings schon ein paar Jahre her und klangen irgendwie Deutsch. Fehlt nur noch ein Heil Hitler! So kommen wir doch nicht weiter“.
„Hör doch mit dem alten Gewäsch von gestern auf. Wir werden Operation `Atlante´ vornehmen, um uns die Schande einer Niederlage in Dien Bien Phu zu ersparen. Beim Rückzug sind alle schweren Waffen zu zerstören“.
Navarre baute sich mit geballten Fäusten auf dem Tisch vor Cogny auf. Der blieb jedoch immer noch locker und putzte in seinem Sessel recht gelassen seine Brille, hauchte die Gläser und polierte sie mit einem sauberen Tuch. Seinen Vorgesetzten würdigte er dabei keines Blickes: „Navarre, das ist doch absoluter Quatsch. Sie sind ein Zocker. Im Gegensatz zu Ihnen, der die Soldaten nur als eine Aufreihung von Zahlen ansieht, liegt mir was an der Truppe. Viele kenne ich, nicht nur de Castries, wie Sie, Chef. Mir liegt vor allem daran, dass wir soviel wie möglich von unseren Jungs da lebend rausholen“, dabei schwankte Cognys Stimme von einem Pianissimo ins Fortissimo und wurde konkreter: „Aber doch nicht durch einen apokalyptischen Rückzug, der massenweise Opfer zur Folge haben wird. Wir brauchen mehr Flugzeuge, mehr Bomber, mehr Fallschirmjäger, mehr besseres Wetter, mehr medizinische Versorgung für die Verwundeten und keine unnützen Durchhalteparolen oder Befehle, die nichts taugen“.
Kurze Pause.
Cogny nippte an seinem Cognac. Navarre schaute aus dem Fenster, um wieder in einem gemäßigten Ton zynisch das Gespräch an sich zu reißen. Er lachte kurz, drehte sich zu Cogny und fuhr in einer überschlägigen Stimme fort: „Verwundete? So was gibt es eben im Krieg oder nicht? Die interessieren mich im Moment nur soweit, dass sie für den Kampfablauf nicht hinderlich sein sollen. Wegen denen werden die meisten Flugzeuge vom Himmel geholt. Diese kommunistischen Barbaren schießen doch genauso Flugzeuge mit dem Roten Kreuz ab wie reguläre Kampfmaschinen. Nur die Starken überleben eben“.
Cogny verschaffte sich deutlich Luft: „Mein lieber Vorgesetzter Navarre. Glauben Sie etwa, dass Ihr vulgärer Darwinismus die Lage in Dien Bien Phu verbessern wird? Vergessen Sie es. Auf diesem Niveau brauchen wir doch nicht zu diskutieren. Sie sind ein Bückling des Sarkasmus geworden“.
Der auf und ab laufende Navarre erneut wie ein in die Enge getriebener Tiger: „Sarkasmus. Na und? Bleiben wir doch auf dem Boden der Tatsachen. Wenn das in die Hosen geht, dann ziehen Sie sich mal warm an, mein Lieber. Ich habe noch einen Termin mit Konsul Sturm. Dem muss ich während der Opernaufführung Zuckerwatte in seinen Allerwertesten blasen, damit die Amis was locker machen. Ein Opernbesuch würde Ihnen auch guttun. Ein wenig Abwechslung, Kultur, den Geist öffnen. Vielleicht löst das bei Ihnen ja eine Kreativphase aus. Für uns beide muss doch im Moment klar sein, dass wir alles brauchen können, nur keine Sesselpfurzer aus Paris und dollarwedelnde Klugscheißer. Sind wir nicht schon mit den Vietminh genug gestraft, muss ich mir auch noch das entsetzliche Französisch dieser amerikanischen Parlamentarier anhören? Die sprechen ja nicht mal ein ordentliches Englisch“.
Die Telefon- und Telegrafenleitungen in die USA glühten. CIA und Pentagon wurden von Meldungen ihrer Agenten über die katastrophale Situation der Kolonialtruppen in Dien Bien Phu überschüttet. Admiral Radford mit Unterstützung von Vizepräsident Richard M. Nixon machten sich daran, die streng geheime Operation „Vulture“ voranzutreiben. Präsident Eisenhower bremste die Sache ab, da Korea ihm noch wie Blei in den Knochen hing und die Indochina-Konferenz in Genf vorbereitet wurde. Noch so ein teures, kostspieliges Abenteuer, dies dem Kongress und dem Senat beizubringen, erscheint ihm im Moment nicht sonderlich ratsam. Wenn schon der eigene Stabschef General M. Ridgway gegen dieses Unternehmen ist, so ist die Sache doch äußerst fraglich. Die Befürchtungen, dass sich die Chinesen einmischen, sobald die USA einen militärischen Luftschlag durchführen, sind nicht von der Hand zu weisen. Dien Bien Phu soll nicht gerade der Anlass für einen 3. Weltkrieg sein.
Zeit gewinnen, Genf abwarten, die Briten fragen und wenn die nicht mitziehen, dann das Buch mit dem Titel Dien Bien Phu endgültig zuklappen.
Saigon, 2. April
Navarre las ein Telegramm und brüllte los: „Cogny ist ein Schwein. Er verrät mich, wo er nur kann. Schauen Sie sich mal das alles an, was er gegen mich vorwirft. Bei der kleinsten Kleinigkeit ist er beleidigt wie eine blutige Leberwurst. Und jetzt droht er mir sogar damit, mich noch zu verprügeln. Jetzt will dieses Schwein nicht mehr unter meinem Befehl arbeiten. Der wird sich noch wundern. Dem werde ich sein Dien Bien Phu schon noch versalzen!“. Navarre zu seinem Adjutanten, nachdem es zwischen den beiden Streithähnen Navarre und Cogny zum offenen Bruch gekommen war.
10. April 1954
Neue Hiobsbotschaften aus dem Befehlszentrum Hanoi.
Der französische Geheimdienst informierte, dass Funkgespräche von Giap abgehört wurden, wonach gut ausgerüstete und getarnte 25.000 Vietminh der Reserve mobilisiert und nach Dien Bien Phu in Marsch gesetzt wurden. Ein weiteres Flugabwehrregiment mit 67 Geschützen, Kaliber 37mm, kam frisch ausgerüstet aus China.
Das 2. Fallschirmjägerbataillon der Fremdenlegion (2. BEP) mit 550 Paras unter Major Liesenfelt wurde in der Nacht abgesetzt und ermöglichte so einen Gegenangriff im Osten.
General Giap bekam unerwartet Ärger mit seinen eigenen Bo Doi. Ein Gefangener aus dem Stab des Generals schilderte den Franzosen:
„Einige der Kommandeure weigerten sich geschlossen, weiterhin in den Tod zu stürmen. Die schwere gegnerische Feuerkraft und der immense Einsatzwille der Kolonialtruppen, vor allem den Legionären und den Fallschirmjägern, unterschätzten wir Angreifer und es schreckte uns bis ins Mark. Die Verluste von uns Bo Doi sind dramatisch in die Höhe geschnellt. Alleine die Kämpfe um `Huguette`, `Eliane´ und `Dominique´ kosteten uns (Vietminh) um die 10.000 Tote und Verwundete. Die chinesischen Politkommissare brüllten unsere geschätzten Regimentskommandeure wie wild an und fuchtelten mit ihren Pistolen vor deren Nase umeinander. General Giap musste selbst eingreifen und beschwichtigte die Politkommissare. Eine Bewegung von antikommunistischen Aufwieglern nannte Giap die Verweigerer, stellte sich dennoch schützend hinter sie und verabschiedete die chinesischen, politischen Kommissare“.
Paris – London – Washington D.C.
Die Regierungen der Länder Frankreich, Großbritanniens und den USA prüfen die Pläne für die Operation „Vulture“. Die B29-Bomber sollten die französischen Hoheitsfarben aufgepinselt bekommen. Amerikanische Piloten sollten die eigene Nationalität aufgeben und in den Status von Fremdenlegionären versetzt werden. Also keinerlei amerikanische Dokumente oder Ausweise bei dem geplanten Einsatz. Die Sitzung dauerte keine halbe Stunde.
Premiere Winston Churchill und sein Außenminister Sir Anthony Eden weigerten sich, Großbritannien in ein koloniales Abenteuer zu stürzen.
Sie verwiesen auf die Indochinakonferenz in Genf. Deren Ausgang galt es abzuwarten.
Somit war für Churchill, sich in irgendeiner Form an „Vulture“ , einem Atomschlag zu beteiligen, erstmals vom Tisch. Er schob den Schwarzen Peter den USA direkt und alleine zu.
25. April Hanoi – Saigon
General Cogny gab nach Saigon zu seinem Vorgesetzten General Navarre durch: „...nach den letzten Ereignissen gehe ich davon aus, dass sich DBP mit Unterstützung vielleicht noch zwei bis drei Wochen halten kann, es sei denn, der Feind setzt zur Generalattacke an. Sollte kein Nachschub eintreffen, dann dauert es keine acht Tage und der Ofen ist aus. Ich empfehle dringend, dass die Operation `Condor´ schnellstens einzuleiten ist. Ich kann es nicht weiter vertreten, weitere Freiwillige in DBP abzusetzen“.
Antwort aus Saigon.
Navarre teilte Cogny in einem Telegramm mit: “… vertrete ich die Meinung, dass DBP weiterhin verteidigt wird und die Operation `Condor´ verschoben werden muss...“.
Genf - Schweiz
Die Eröffnung der Konferenz über Korea und Indochina wurde in Genf (Schweiz) vorbereitet. Die Außenminister Frankreichs, Großbritanniens, den USA, der UdSSR, die Delegierten Nordkoreas und der assoziierten Staaten sowie der Volksrepublik China bezogen in Genf ihre Unterkünfte.
London - England
27. April 1954. Minister Churchills `House of Commons´ teilte offiziell mit, dass Großbritannien sich in keine militärische Auseinandersetzung in Indochina begeben wird.
Genf - Schweiz
28. April 1954. In Genf kann die Indochina-Konferenz nicht beginnen, da die Verhandlungen mit Korea noch nicht in die Gänge gekommen sind, obwohl die Feindseligkeiten seit neun Monaten eingestellt worden sind. Protokollfragen werden den Beginn bis zum 10. Mai hinauszögern.
Washington D.C. - USA
29. April 1954. Präsident Eisenhower teilte in einer Pressekonferenz mit, dass die USA ein alleiniges Engagement in Indochina nicht tragen werde.
Dien Bien Phu
Die Soldaten in Dien Bien Phu sind nun von den verbündeten Großmächten abgeschrieben und sich selbst überlassen.
03. Mai 1954 Angaben der Vietminh
„In der Nacht löschte Regiment 36 die Anhöhe 311B (`Claudine 5´), westlich von Muòng Thanh aus. Mittlerweile kontrollierten unsere Truppen das Gelände bis 300 m an den französischen Befehlstand um „Fuchsgesicht“.
De Castries besuchte, seit Wochen zum ersten Mal mit zugehobener Nase, die ca. 1.260 Schwerverwundeten im Feldlazarett des Arztes Grauwin.
04. Mai
Die letzte, nichtdienstliche Meldung aus Hanoi traf ein. Lt. Dèsirè, in `Isabelle´, erfuhr auf diesem Weg von der Geburt seiner Tochter, welche den Namen seiner Bastion Annemarie erhielt, auf der er sich befand, bevor die T’ais das Weite suchten“. (Seine Frau war extra aus Frankreich angereist, um das gemeinsame Glück in Hanoi gebührend zu feiern. Lt. Michael Dèsirè überlebte die Schlacht nicht“.
Das Ende von der Garnison in Dien Bien Phu
07. Mai 1954
Paris
Auf den ersten Seiten aller Pariser Zeitungen konnte man das Sterben der Garnison mitverfolgen. Kaum ein Pariser nahm davon wirklich Notiz. Zu weit entfernt, Kolonialkrieg, schmutziger Krieg, die dort kämpfen sind keine von uns, passt nicht in unsere Welt!“
Die allgemeinen Äußerungen der französischen Bevölkerungen waren mehrheitlich negativ gegenüber dem Engagement in Indochina.
Dien Bien Phu
Um 10:00 erfolgte über Funk ein offenes Gespräch zwischen Cogny und de Castries, welches die allgemeine Lage in seiner absurden Tragik und Hilflosigkeit widerspiegelte:
„Bonjour, alter Junge“, sagt Cogny. „Wie geht’s, wie ist die Lage? Welche Einheiten stehen noch zur Verfügung?“
De Castries: „Alles Merde. Folgende Befestigungen sind gefallen: E2, E4, E10. Mir bleiben das 6. BPC und Reste vom 1. und 2. BEP sowie einige von den algerischen Schützen“.
Cogny: „Ja!?“
De Castries: „Können nichts mehr Vernünftiges ausrichten“.
Cogny: „Ja!?“
De Castries: „ N’est-ce pas? (Nicht wahr?). Diese Reste sind aber sehr schwach, wir kämpfen mit den letzten Reserven an der Ost- und Westseite. Wir schmeißen uns von einem Eck in das nächste...“
Cogny: „Ja!?“
De Castries: „Nicht wahr. Mir bleiben nur noch zwei Kompanien von den zwei BEP’s, zusammen ...“.
Selbst die Verbindung gab nun den Geist auf und es knisterte stark.
Cogny: „Ja. Hallo, hallo?“
De Castries: „Nicht wahr? Drei Kompanien marokkanischer Schützen, die taugen natürlich nichts mehr, denn die sind völlig im Eimer...“.
Cogny: „Ja?“
De Castries: „ Nicht wahr, dann zwei Kompanien vom 8. Sturmbataillon“,
Cogny unterbrach: „Ja. Schön“.
De Castries: ... dann noch drei Kompanien T’ais vom 2 BT, was aber normal ist. Die haben mit den marokkanischen Schützen noch die meisten Männer. Die kämpfen ja auch nicht richtig“.
Cogny: „Sicher, sicher!“
De Castries: „Nicht wahr! Und da sind noch zwei Kompanien Fremdenlegionäre, Reste von der 1. vom 2 Infanterie Regiment…, vielleicht zwei Kompanien von der 13. Halbbrigade mit 70 oder 80 Mann“.
Cogny: „Jawohl, ich habe verstanden!“
De Castries: „Gut, gut, wir kämpfen mit den Zähnen und den Fingernägeln“.
Cogny: „Ja“.
De Castries: „Nicht wahr. Mit Zähnen und Fingernägel wollen wir sie am Nam Youm stoppen“.
Ein Knistern im Funk unterbrach erneut kurzfristig das Gespräch.
Cogny hörte man schreien: „Hallo, hallo...“.
De Castries: „Hallo, mon General..., verstehen Sie mich, können Sie mich hören?“
Cogny: „ Könnt Ihr euch noch einigermaßen bewegen?“
De Castries: Wir müssen die Vietminh am Fluss stoppen“.
Cogny: „Ja?“
De Castries: „Nicht wahr. Am Ostufer müssen wir den Feind zum halten bringen. Ansonsten sind wir ohne Wasser, das wäre nicht gut“.
Cogny: „Ja. Ja richtig, überhaupt nicht gut“.
De Castries: „Nicht wahr? Wir wollen heute Nacht ausbrechen. Die 312. und 316. Division rücken vom Osten her mit den Regimentern 88 und dem 102. von der 308. Division vor. Mist, die treiben sich überall herum. Das 36. Regiment rennt die westliche Flanke von uns an. Die Ausbruchoperation `Albatros´ muss schneller umgesetzt werden“.
Cogny: „Natürlich. Ich habe Rückendeckung von Navarre“.
De Castries: „Ich schlage ihnen vor, ich habe mit Langlais und den anderen gesprochen, wir sind uns da einig, möglichst viele nach dem Süden abhauen zu lassen. Nur die vielen Verwundeten bereiten mir Kummer. Die müssen wir alle da lassen. Und die „Ratten“ vom Nam Youm können zusehen, wie sie durchkommen. Nicht wahr?“.
Cogny: „Ja. Natürlich“.
De Castries: „Ich bleibe hier und schließe den Laden mit ein paar tapferen Kerlen ab“.
Cogny: „Das wars wohl“.
De Castries: „Nicht wahr? Viele Verwundete sind eh schon in den Händen des Feindes. Auf `Eliane 4´ und `Eliane 10´. Jede Menge Verwundete... ein Jammer“.
Cogny: „Ja natürlich. Ein Jammer“.
De Castries: „Nicht wahr. Ich werde alles unter mein Kommando nehmen und mache weiter bis zum Schluss“.
Cogny: „Klar doch, alter Junge, klar doch...“.
De Castries: „Nicht wahr. Ich werde versuchen, Sie nochmals anzurufen, bevor hier Feierabend ist“.
Cogny: „Selbstverständlich, ich bin ja da“.
De Castries: „Ich versuche solange als möglich mit meinen Einheiten, die mir noch zur Verfügung stehen, auszuhalten, ... ich habe nichts mehr zu sagen..., mon General...?“
Ein Knistern in der Sprechanlage behinderte wieder das Gespräch.
Cogny: „Alter Junge, Kopf hoch, wird schon schiefgehen“.
De Castries: „So ist das ... wird schon schiefgehen“.
Cogny: „Haben Sie noch genügend Munition?“
De Castries: „Nein, verdammt, ... nichts mehr, gar nichts“.
Cogny: „Alter Junge, hast du wirklich gar nichts mehr ...?“
De Castries: „Nichts mehr, verstehen Sie, nichts, aus, alles verballert“.
Cogny: „Nur jetzt nicht, oder? Und die guten 10,5 Zentimeter Granaten ...?“
De Castries: „Na, da habe ich vielleicht noch 100 oder 150 Stück...“.
Cogny: „Schön, und?“
De Castries: „Nicht wahr. Aber überall verstreut. Verstehen Sie?“
Cogny: „Ja, natürlich“.
De Castries: „Wir halten aus, solange es eben geht“.
Cogny: „Ich glaube, es wird das Beste sein, wenn unsere Luftunterstützung Angriffe fliegen wird, damit die Vietminh gebremst werden“.
Die Verbindung knisterte wieder stark.
Cogny: „Ja, bitte? Hallo alter Junge, hallo ...“.
Störungen. Die Verbindung wurde unterbrochen. Wortfetzen kamen herüber: „...das 88. Regiment..., die 316. Division... sie sind überall....“
Das Rauschen verschwand.
De Castries: „ Ich werde Befehl geben, auszubrechen. Nach Süden über `Isabelle´auszubrechen.
Cogny: „Ja natürlich. Halten Sie mich auf dem Laufenden, damit wir Ihnen massiv Luftwaffenunterstützung herbeiführen können“.
De Castries: „ Aber natürlich, mon General“.
Cogny: „Auf Wiedersehen, alter Junge“.
De Castries: „Au revoir, mon General“.
Cogny: „Au revoir, alter Junge“.
De Castries hängt den Hörer in die Gabel.
In Hanoi saß ein verzweifelter General Cogny, welcher seinen Offizieren nicht in die Augen schauen konnte.
http://www.epee-edition.com/index.php/de/onlineshop/biografien-1/dien-bien-phu-detail