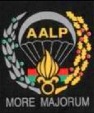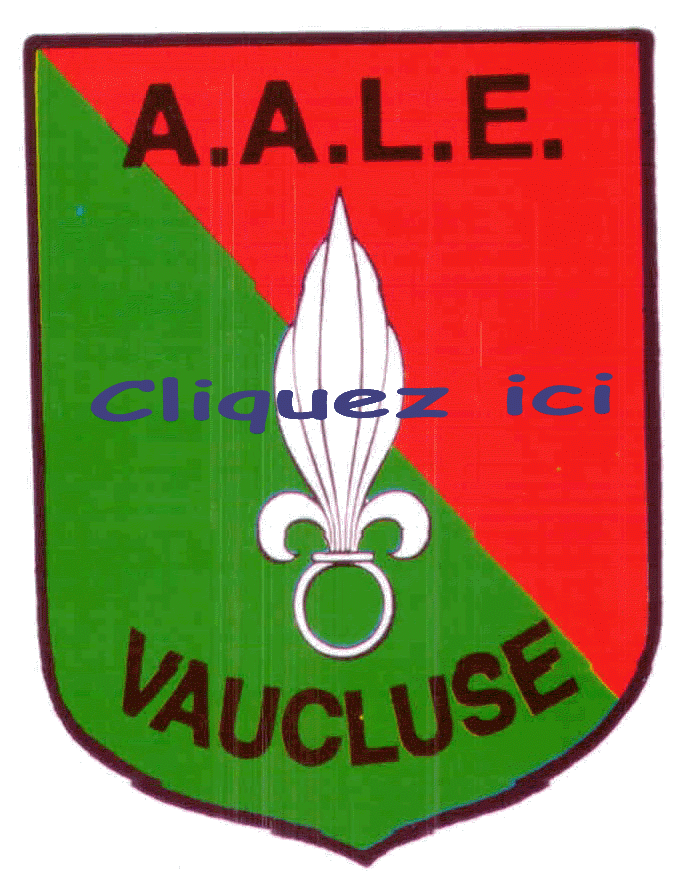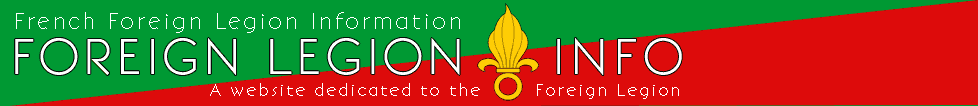Samstag, 17.02.2007
Auch wenn sich manches verändert hat – in der Fremdenlegion gelten noch immer die alten Riten und Werte.
Der Mann ist fertig mit sich und der Welt. Allein hockt er unter einem Mangrovenbaum am Flussufer. Dass er weint, fällt im Tropenregen nicht auf. Aber jetzt wäre es ihm auch egal. Er wehrt sich nicht mal mehr gegen die Moskitos. Frank ist erschöpft und hungrig. Seit ihn die anderen Frankieboy nennen, verflucht er den Tag, an dem er sich zur Einzelkämpfer-Ausbildung gemeldet hat.
Die Szene spielt in Régina, dem Trainingscamp der Fremdenlegion im Dschungel von Französisch- Guyana. „Nur wer bei uns durchhält, der überlebt auch anderswo“, grinst Sergeant Lopez, einer der Ausbilder. Was sich hinter seinem Grinsen verbirgt, merken die Neuen schon beim Appell. Der Unteroffizier ist Spanier und einer von den ganz Harten. „Spaß versteht der nur nach Dienstschluss“, äußert sein Kompaniechef anerkennend.
Aber hier sind die Legionäre immer im Dienst, sechs Wochen lang, ohne einen freien Tag, ohne Feierabend, ohne Kontakt zur Außenwelt, allein im Dschungel.
Training im Dschungel
Das 3.Regiment der Legion Etrangère bietet das anerkannt beste Militärtraining für den Kampf in den Tropen. Deshalb schicken neuerdings auch fremde Armeen ihre Soldaten: Gerade sind Brasilianer da, im nächsten Monat kommt ein Trupp Thailänder. Frankieboy ist Schotte und hat sich für fünf Jahre verpflichtet. Aber zum Abschlusstest wird er nicht mehr antreten. Ob es für ihn noch eine Zukunft gibt bei der Truppe, entscheiden seine Vorgesetzten.
Am Amazonas hat die Legion ein ideales Übungsgelände: alle Widrigkeiten der Natur, aber keine Zeugen. Tief im Wald ist ein Dschungelgefängnis nachgebaut, mit Bambuskäfig, Palmhütten und Wachturm, genau so, wie es verzweifelte Geiseln in Kolumbien, auf Borneo oder in Afrika erlebt haben. An den Terroristen sind allerdings nur die Zigarren echt. Die sadistischen Bewacher spielen sie aus dem Stehgreif. Ihr Gefangener im Wasserloch weiß, dass er befreit wird. Und seine Wärter wissen es auch. Nur wann die Kameraden angreifen werden, das wissen sie nicht.
Chef Lopez hat seinen Männern eingebleut, wie wichtig bei Kommandounternehmen das Überraschungsmoment ist.
Quälerei bis an die Grenze
Diesmal geht es zwar nicht um Leben oder Tod, aber um Punkte in der Personalakte. Geschossen wird mit Übungsmunition und Farbpatronen, nur die Handgranaten sind scharf. Die jungen Legionäre sollen ein Gespür für die Gefahr bekommen. Ist ein lautloser Angriff befohlen, dann töten sie ihre Feinde mit der Drahtschlinge oder notfalls mit bloßen Händen. „Das ist gar nicht so schwer“, versichert ein baumlanger Carporal und demonstriert es mit einem schnellen Griff an die Gurgel. Der Mann stammt aus Bosnien und weiß, wovon er spricht.
Frankreichs Glorie ist Vergangenheit. Doch der Fremdenlegion hängt noch immer ihr legendärer Ruf aus der Zeit der Kolonialkriege nach. Jahr für Jahr bewerben sich Tausende junger Ausländer. „Bei uns landet das Strandgut der Gesellschaft“, sagt Colonel Bertout und schaut dabei versonnen aus dem Fenster seines Büros. „Die Glücklichen bleiben zu Hause.“
Die Legion kann es sich leisten, wählerisch zu sein. Von acht Kandidaten fallen sieben durch. Eine Chance hat nur, wer mindestens 18Jahre alt ist und höchstens 40, dazu unverheiratet, gesund und anpassungsfähig. Gebrochene Herzen zählen nicht, und nach Schulden fragt keiner. Nur fürs Strafregister interessiert sich der militärische Geheimdienst, getarnt als „Agentur für Statistik“.
Wie in alten Zeiten unterhält die Fremdenlegion überall in Frankreich Rekrutierungsbüros. Wer sich dort meldet, erhält eine warme Mahlzeit und eine Fahrkarte nach Marseille. Im Hauptquartier der Legion werden die Bewerber drei Wochen lang getestet. Medizinisch, psychologisch und ganz besonders im Hinblick auf ein künftiges Leben nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam.
Westeuropäer kommen immer weniger, und längst ist ein Deutscher die exotische Ausnahme. „Den Kerlen geht’s daheim zu gut, die kleben an Mamas Rockzipfel“, vermutet Hans Eberle aus Karlsruhe, der als 18-Jähriger von zu Hause ausgerissen ist. Seitdem sind drei Jahrzehnte vergangen, und er hat sich hochgedient zum Offizier.
Im Dschungel Guyanas versucht Chef Lopez derweil alles, um aus Männern Soldaten zu machen, die sprichwörtlich weder Tod noch Teufel fürchten. Kaum einer hat geahnt, was ihn erwartet: Quälerei bis an die physischen Grenzen und darüber hinaus. Hitze, Giftschlangen, Dauerstress und der Terror der Ausbilder. Die Soldaten werden geschunden bis zum Umfallen, nach der simplen Formel: „Jeder Tropfen Schweiß spart einen Tropfen Blut.“
Über das, was bei der Bundeswehr einen Skandal auslöst, können Legionäre nur müde lächeln. Die Grenzen zwischen Drill und Folter sind hier fließend. Und keiner kommt auf die Idee, sich zu beschweren. Es würde nichts ändern. Körperlich fit zu sein, ist für jeden Legionär ohnehin erste Pflicht. Wer beim Sport versagt, dem droht unehrenhafte Entlassung.
Die Legion lebt von ihrem Image, richtigen Männern die letzten Abenteuer zu bieten, getreu dem ungeschriebenen Auftrag: kämpfen, saufen, huren. Doch die Realität ist nicht mehr ganz so krass. Die meisten kämpfen nur gegen den inneren Schweinehund. Alkohol ist hier verboten und an Frauen nicht zu denken. Wer sich abends in seine Hängematte rollt, hat ganz andere Sorgen: Blasen an den Füßen, Schwielen an den Händen, Schmerzen im Kreuz.
Mix aus Angst und Respekt
Die Kommandosprache der Legion ist Französisch. Wer nach Guyana versetzt wird, hat die Grundausbildung hinter sich und 500 Vokabeln gelernt. Aber oft geht es wild durcheinander mit den Sprachen. „Curva“, brüllt einer aus dem dreckigen Dutzend, dem sein Kamerad beim Klettern mit den Stiefeln auf die Finger gestiegen ist. Curva ist polnisch und heißt Nutte. Hier im Camp dient es als Allzweck- Schimpfwort. Kein Fluch, kein Anschiss, der nicht mit Curva beginnt.
Im Lehrgang werden die Legionäre zu Nummern. „Du bist Nummer elf“, brüllt Schinder Lopez einen jungen Russen an. „Opfer Nummer elf.“ Das Donnerwetter wie ein Mann wegzustecken, gehört zum Programm. Wer sich nicht unterordnen kann, hat schon verloren. Die Chefs wollen nicht geliebt werden.
Im Gegenteil: Eine Mischung aus Angst und Respekt treibt die jungen Legionäre voran. Und ihre Verehrung für Antonio Lopez. Er ist ihr Vorbild. Sie wollen so werden wie er. Für einen Alltag im Schlamm und hinter Stacheldraht, für wenig Schlaf und reichlich Hunger zahlt die Legion gut elfhundert Euro im Monat, steuerfrei. Anreiz genug für Männer, die in ihrer Heimat viel weniger verdienen würden. Die meisten von ihnen haben nicht nur ihren Pass abgegeben, sondern auch ihren Namen. Wenn eine enttäuschte Freundin oder eine verzweifelte Mutter bei der französischen Botschaft nachforscht, erhält sie einen Brief mit der stereotypen Antwort: „Ein Mann dieses Namens ist der Legion Etrangère im fraglichen Zeitraum nicht beigetreten.“
Vielen Legionären ist das gerade recht. Sie haben mit ihrem alten Leben gebrochen und wollen ein neues anfangen. Wer 15 Jahre durchhält, wird mit der französischen Staatsbürgerschaft belohnt, mit einer ordentlichen Pension und mit einem Platz im Altersheim. Oder auf dem Ehrenfriedhof.
Der ehemalige Befehlshaber General Négrier hat das Legionärsschicksal mal auf den Punkt gebracht. „Männer“, rief er bei einem Truppenappell in den sechziger Jahren, „ihr seid gekommen, um zu sterben.“ Dann machte er eine Kunstpause. „Und ich werde euch dorthin schicken, wo ihr sterben könnt.“ Seitdem hat sich einiges geändert in der Legion. Die Unterkünfte sind modernisiert worden. Das Essen wurde besser. Offiziere und Unteroffiziere riskieren jetzt ihre Degradierung, wenn sie Untergebene prügeln. Früher setzte es Kolbenhiebe bei jeder Gelegenheit. Da reichte es schon, wenn einer falsch sang.
„Wir haben die Sprache verdammt viel schneller gelernt als die Burschen heute“, knurrt ein vierschrötiger Finne, der offenbar den alten Zeiten nachtrauert.
Skrupel sind unerwünscht
Aber längst nicht alle halten durch. Wer unbedingt weg will, den lässt man gehen. Und anders als früher müssen selbst Deserteure nicht mehr mit langen Haftstrafen rechnen. Nur wer mit Waffe flüchtet, mit dem machen sie kurzen Prozess. Im vorigen Herbst soll ein Portugiese in den Pyrenäen von der Militärpolizei erschossen worden sein. Dass solche Meldungen nicht offiziell bestätigt werden, gehört zum Selbstverständnis der Truppe.
Noch immer ist die Fremdenlegion so eine Art Bruderschaft für Männlichkeit pur. Wer Skrupel hat, geht nicht zur Legion. Und der tägliche Kampf gegen die Natur und gegen den unsichtbaren Feind lässt Zweifel gar nicht erst aufkommen. Bei 40 Grad Celsius, hungrig und müde, diskutiert keiner über Krieg und Frieden.
„Die Fremdenlegion ist eine geniale Erfindung“, urteilt ein amerikanischer Diplomat voller Neid, „weil sie ohne innenpolitische Probleme überall auf der Welt eingesetzt werden kann.“ Im Klartext soll das heißen: Wenn die Sache mal schiefgeht, liegen in den Särgen wenigstens keine toten Franzosen.
![]()